Datenräume für das zukünftige Energiesystem
Wärmepumpen, PV-Wechselrichter und Batterien, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Lüftungssysteme: Die Elektrifizierung schreitet voran. Die Digitalisierung ist zentral, damit diese neuen Verbraucher und Speicher effizient ins Stromsystem integriert werden können. Dabei geht es nicht nur darum, Daten zu erheben, sondern sie auch system- und akteurübergreifend in sogenannten Datenräumen zugänglich zu machen.
In Datenräumen können Nutzer ihre Daten für von Ihnen bestimmte Zwecke auf gesicherte Art zur Verfügung stellen. Datenräume ermöglichen so die Nutzung bisher verschlossener Datenquellen für Anwendungszwecke wie Flexibilitätsdienste, Energiemanagement und Energieeffizienz. Damit diese Datenräume vertrauenswürdig sind, müssen Zugang, Bearbeitung und Weiterverwendung der Daten klar geregelt und geschützt sein.
Die EU arbeitet schon länger an einem Energiedatenraum, der die aufwändige Installation zusätzlicher Netzwerkkomponenten in Gebäuden überflüssig machen soll. Der Bundesrat hat sich bereits 2022 für die Schaffung solcher Datenräume ausgesprochen (Medienmitteilung vom März 2022), damit das Potenzial von Daten besser genutzt werden kann – explizit auch für den Bereich Energie. Eine Studie der Hochschule Luzern und des Neuenburger Technologie-Innovationszentrums CSEM vertieft erstmals Fragen, wie ein Datenraum für die Schweiz im Energiesektor aussehen könnte, wie erste internationale Ansätze dafür genutzt werden können, und welche Fragen noch zu beantworten sind.
Was heisst das nun ganz konkret? Energeiaplus hat bei den Autoren nachgefragt. Matthias Galus, Leiter Sektion Digitale Innovation und Geoinformation im Bundesamt für Energie, Christoph Imboden vom Institut für Innovation und Technologiemanagement und Andreas Rumsch vom iHomeLab der Hochschule Luzern (HSLU) ordnen ein.
Was für Daten würden in diesem Raum «aufbewahrt»?

Andreas Rumsch, iHomeLab, Hochschule Luzern, Bild: HSLU
Andreas Rumsch, HSLU: Die Daten selbst werden nicht im Datenraum gespeichert. Der Datenraum ermöglicht lediglich einen geregelten, standardisierten und kostengünstigen Zugang zu Daten, die dezentral bei Akteuren liegen. Genau das ist der grosse Vorteil eines Energiedatenraumes. In einem Haushalt steht eine grosse Menge an Geräten (z.B. Kühlschrank, Wärmepumpe, PV-Anlage, Elektromobil) deren Hersteller, jeder für sich, Daten aus ihren Geräten auslesen und bewirtschaften. Ein Datenraum orchestriert nun den Zugriff auf die Daten der einzelnen Haushalte. Voraussetzung dafür ist, dass die Eigentümer der Daten dem zustimmen. Zusammengeführt sind die Daten sehr wertvoll. Mit Leistungs-, Verbrauchs- und Prognosedaten kann beispielsweise der Eigenverbrauch der PV-Produktion auf dem Hausdach optimiert werden, oder das Laden des Elektrofahrzeugs lässt sich optimiert steuern.

Matthias Galus ist zuständig für Digital Innovation im Bundesamt für Energie; Bild: BFE
Matthias Galus: Wir reden hier nicht über einen zentralen Datenspeicher, sondern über eine Art standardisierten Zugriff auf Daten der Konsumenten und Konsumentinnen. In den analysierten Fällen in der Studie geht es primär um Daten von erneuerbaren Energieanlagen, Wärmepumpen, Speichern und Elektrofahrzeugen. Natürlich könnten auch Daten von Herstellern von Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen, Haushaltgeräten oder PV-Wechselrichter integriert werden. Über eine App könnte ich einen Dienstleister berechtigen, meine Daten zu beziehen. Der Dienstleister erhält bestimmte Daten dann direkt von diesen Unternehmen. Auf Basis der Daten kann der Dienstleister mir beispielsweise aufzeigen wie ich meinen Energieverbrauch optimieren kann oder diesen sogar in meinem Auftrag steuern.
Und was könnte der Dienstleister dann mit diesen Daten anfangen? Können Sie ein Beispiel geben?
Christoph Imboden, HSLU: In der Studie haben wir verschiedene Anwendungsfälle in den drei Ökosystemen «Gebäudeinformation», «Energie und Netze» sowie «Smart Home und Komfort» identifiziert. Viele der Anwendungsfälle haben das gleiche Ziel – den Energiekonsum zu minimieren. Ein weiteres Beispiel: Mit Daten von Gebäudesensoren, die beispielsweise Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -qualität und Energieverbrauch messen, erhalten die Betreiber des Gebäudes wertvolle Einblicke zur Gebäudeleistung. Durch die Analyse dieser Daten können sie beispielsweise Kosteneinsparungen identifizieren, die Rentabilität steigern und die Umweltbilanz des Gebäudes verbessern. Oder durch die Nutzung von Sensordaten und künstlicher Intelligenz kann das Wohnen älterer oder beeinträchtigter Menschen sicherer und komfortabler gestaltet werden.
Die Digitalisierung nimmt eine Schlüsselrolle ein bei der Umgestaltung des Energiesystems. Beispiel: Smart Meter, die zeitnahe Daten zum Energieverbrauch liefern. Oder Energiemanagementsysteme, die Nutzung und Produktion steuern können. Welchen Nutzen können Datenräume da bringen?

Christoph Imboden, Institut für Innovation und Technologiemanagement, Hochschule Luzern, Bild: HSLU
Christoph Imboden, HSLU: Im Fall von Energiemanagementsystemen ermöglichen Datenräume beispielsweise, dass die Daten nicht an jedem Standort der Datenquelle verarbeitet werden müssen. Vielmehr werden die Daten aus den Geräten einem berechtigten Dienstleister im Web zugänglich gemacht und dieser übernimmt das Energiemanagement für verschiedene Standorte. Das führt zu grossen Kosteneinsparungen, einer Marktdynamisierung und auch zu einer Reduktion der Datenmenge, die transferiert und gespeichert werden muss. Durch die Nutzbarkeit von potentiell vielen verschiedenen Messpunkten können die angebotenen Funktionen einfacher weiterentwickelt werden. Vorhersagen und Optimierungen des Energieverbrauchs können genauer erfolgen. Das führt zu mehr Energieeffizienz, Flexibilität und überhaupt zu einer viel besseren Ausnutzung der physischen Infrastruktur.
Matthias Galus: Solche Daten sind äusserst wertvoll. Allein ein Zugang zu Smart Meter Daten ermöglicht beinahe 10% Energieeinsparungen. Das zeigen Auswertungen von Energieversorgern (z.B. Centralschweizerische Kraftwerke CKW). Eine Verknüpfung mit anderen Daten ermöglicht sicherlich noch mehr und auch andere Nutzen. Ein grosses Problem ist die heute nicht vorhandene Interoperabilität der Geräte, wie etwa PV-Anlage, Kühlschrank und Lüftung. So setzen bestehende Energiemanagementsysteme oft auf lokale, zusätzliche physische Infrastruktur, sogenannte Gateways. Diese Hardware ist teuer. Preis und Komplexität schrecken Nutzer und Nutzerinnen ab – absolut nachvollziehbar. Das bremst die Energietransformation. Datenräume ermöglichen es, die Daten direkt beispielsweise ab der oft sowieso vorhandenen Cloud des Herstellers über eine Schnittstelle (API) zu beziehen. Das ist viel einfacher und die teure «Bricolage» vor Ort entfällt. Das dynamisiert Innovation and Dienstleistungen.
Daten sind unter Umständen auch eine Art Kapital, das man nicht gerne seiner Konkurrenz zur Verfügung stellt.
Christoph Imboden, HSLU: Das ist richtig. Eine Studie «Data Sharing is a Key Digital Transformation Capability» von Gartner aus dem Jahre 2021 zeigt jedoch, dass Unternehmen, die sich aktiv an Datenaustausch und -analyse beteiligen, einen dreimal höheren messbaren wirtschaftlichen Nutzen erzielen, als Unternehmen, die dies nicht tun. Ferner entsteht ein Zugzwang: Nutzer und Nutzerinnen verlangen immer mehr nach Einbindung ihrer Geräte in cloudbasierte Dienste wie Sprachassistenten und KI gestützte Anwendungen. Gerätehersteller und Dienstleister sind da gefordert.
Wo hapert es am meisten bei der Schaffung solcher Datenräume?
Christoph Imboden: Zum einen sind Datenräume noch kein «Turn-Key -Product». Sie sind also noch nicht fertig entwickelt und «von der Stange nutzbar». Die Technologie muss noch weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Schweizer Akteure angepasst werden. Zum anderen sind Technologie und Möglichkeiten von Datenräumen in der Schweiz noch wenig bekannt. Eine verstärkte Information über Datenräume muss deshalb in den nächsten Jahren erfolgen. Eine neutrale Organisation ist zudem nötig, die beim Aufbau die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure kontinuierlich berücksichtigt.
Und wie geht es jetzt weiter?
Matthias Galus: Dem Bundesrat ist der Aufbau vertrauenswürdiger und interoperabler Datenräume wichtig. Das insbesondere vor dem Hintergrund, dass unsere europäischen Nachbarn ebenfalls in diese Richtung gehen. Es gilt, den Anschluss nicht zu verlieren. Ende 2023 hat der Bundesrat ein Massnahmenpaket beschlossen, das unter anderem einen Verhaltenskodex für vertrauenswürdige Datenräume etabliert und den Aufbau einer zentralen Anlaufstelle Datenökosystem Schweiz vorsieht. Das BFE unterstützt die Arbeiten zu einem Energiedatenraum, vernetzt die Akteure der Energiewirtschaft mit der Anlaufstelle und sorgt für das Zusammenwachsen der laufenden Bottom-Up Initiative der HSLU und des CSEM mit dem Top-Down Ansatz der Anlaufstelle. Das Projekt WILSON der HSLU verspricht, den Aufbau eines Energiedatenraumes in der Schweiz zu stärken.
Interview: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie
Bild: Shutterstock; Stock-Foto ID: 2136227099; DadBusiness
 shutterstock
shutterstock
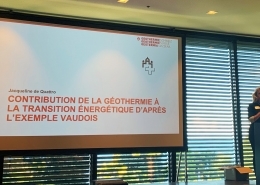 Géothermie: tout le monde en parle
Géothermie: tout le monde en parle  keystoneWas macht das BFE eigentlich im Bereich Rohrleitungen?
keystoneWas macht das BFE eigentlich im Bereich Rohrleitungen?  BFELa diplomatie au service de l'énergie
BFELa diplomatie au service de l'énergie  Flurin Bertschinger / Ex Press /BAFUGut geschützt vor der Katastrophe: Störfallvorsorge bei Erdgasleitungen
Flurin Bertschinger / Ex Press /BAFUGut geschützt vor der Katastrophe: Störfallvorsorge bei Erdgasleitungen 
 Empa/InNET Monitoring AG
Empa/InNET Monitoring AG ©BFE
©BFE
Neuste Kommentare