Ein perfekt geschnittener Rasen, warme Duschen, ein ansprechendes Angebot im Restaurant. Das wollen Golfplatz-Betreiber den Golferinnen und Golfern bieten. Wie sieht es dabei punkto Energieverbrauch aus? Wo gibt es Optimierungspotenzial? Mit einer PEIK-Beratung erhalten Golfplatz-Betreiber Antworten. PEIK ist die professionelle Energieberatung für KMU von EnergieSchweiz, dem Programm für Energieeffizienz des Bundesamts für Energie. Eine solche Beratung hat auch der Golfpark Moossee bei Bern durchführen lassen. Weiterlesen
Schlagwortarchiv für: Bern
La Suisse et la France collaborent de longue date dans le domaine de l’énergie. Leurs échanges d’électricité, de gaz, de pétrole et bientôt d’hydrogène vert contribuent à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de part et d’autre de la frontière. Weiterlesen




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenDer Untergrund als Wärmespeicher: Welche Möglichkeiten und Herausforderungen gibt es?
Im Untergrund liegt ein grosses Energiepotenzial. Die Wärme aus den Gesteinsschichten unter unseren Füssen liefert schon heute einen Beitrag zum Wärmebedarf der Schweiz. Doch der Untergrund könnte auch umgekehrt funktionieren – zum Kühlen oder als Speicher von Wärme. In der Schweiz laufen dazu verschiedene Untersuchungen, die vom Bundesamt für Energie (BFE) unterstützt werden. Energeiaplus zeigt die Möglichkeiten und Herausforderungen. Weiterlesen




 1 Vote(s), Durchschnitt: 4,00
1 Vote(s), Durchschnitt: 4,00öV statt Auto: Wie können Unternehmen nachhaltige Mobilität fördern
Wie animiert ein Unternehmen die Mitarbeitenden am besten, mit Velo oder öV statt mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu kommen? Welche Anreize sind sinnvoll? Antworten auf diese und weitere Fragen findet man im Booklet «Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Mobilitätsmanagement in Unternehmen» von EnergieSchweiz, dem Programm des Bundesamts für Energie für Energieeffizienz.
Das Booklet entstand im Rahmen eines Pilotprojekts, dem sumo (sustainable mobility) Netzwerk für Unternehmensvertreter und -vertreterinnen. Es fasst die Erkenntnisse aus den verschiedenen Webinaren, Innovationssprints und Netzwerk-Veranstaltungen zusammen und ist als praxisnaher Ratgeber und Wissenssammlung gedacht. Es enthält Beispiele von Unternehmen, die gängigsten Herausforderungen oder auch, warum sich das Thema für ein Unternehmen lohnen kann.
Energeiaplus hatte zum Start von sumo drei Firmen vorgestellt, die punkto nachhaltiger Mobilität bereits Massnahmen ergriffen haben, wie öV-Bonus, Parkplatzmanagement oder zur Verfügung gestellte E-Bikes . Auf Mobilitäts-Plattformen, wie mobilservice oder clevermobil, sind zudem weitere Praxis-Beispiele zu finden. Es gibt also bereits zahlreiche Firmen, die eine nachhaltige und energieeffiziente Mobilität anstreben.
Warum braucht es diesen Ratgeber noch? Wer ist angesprochen? Und wie geht es nach der Pilotphase von sumo weiter? Energeiaplus hat bei Martina Zoller, Projektleiterin Mobilität im Bundesamt für Energie nachgefragt.
Energeiaplus: Nachhaltige Mobilität ist bei vielen Unternehmen kein Fremdwort mehr. Firmenflotten werden elektrifiziert. Parkplätze werden kostenpflichtig. Firmen verteilen öV-Gutscheine an Pendlerinnen und Pendler. Wie wichtig sind solche Best-Practice-Beispiele?

Martina Zoller ist Projektleiterin Mobilität im Bundesamt für Energie (BFE); Bild: BFE
Martina Zoller: Solche Praxisbeispiele sind von grosser Bedeutung. Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Unternehmen können eine Vorreiterrolle übernehmen, als Vorbild dienen, andere inspirieren und zu eigenem Handeln motivieren. Neben den sogenannten Good Practices ist es ebenso wertvoll, Erfahrungen darüber zu teilen, welche Vorgehensweisen sich nicht bewährt haben oder besser vermieden werden sollten. Auf diese Weise profitieren alle von den Erkenntnissen und können Fehler vermeiden.
Im Projekt sumo ging es darum, solche Praxisbeispiele sichtbar zu machen und Akteure zu vernetzen. Wie gut ist das gelungen?
Insgesamt haben rund 200 Interessierte mitgewirkt – Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Personen aus öffentlichen Institutionen und Anbieterinnen und Berater von Mobilitätslösungen.
Es fanden zwölf Online-Events und 24 individuelle Coachings statt, in welchen u.a. die Relevanz der nachhaltigen Mobilität in Unternehmen aufgezeigt, Wissen vermittelt wurde und Unternehmen einander mit guten Beispielen inspirieren konnten.
Die Pilotphase von sumo hat gezeigt, dass die Unternehmen vom Teilen von Erfahrungen, auch was die Herausforderungen betrifft, profitieren.
In den Veranstaltungen, die im Rahmen von sumo durchgeführt wurden, hat sich auch gezeigt, wo die gängigsten Stolpersteine sind. Sind es die Mitarbeitenden, die ihr Verhalten ändern müssten? Oder fehlen Anreize?
Unternehmen stehen bei der Förderung der nachhaltigen Mobilität vor verschiedenen Herausforderungen. Teilweise wissen sie nicht, wo den Hebel ansetzen und wie das Unternehmen Anreize schaffen könnte. Und dann gibt es Fehlanreize wie zum Beispiel kostenlose Parkplätze.
Es gestaltet sich oft als schwierig, die etablierten Mobilitätsmuster der Mitarbeitenden aufzubrechen und neu auszurichten. Hinzu kommt, dass in vielen Unternehmen andere Themen als dringlicher und wichtiger wahrgenommen werden als die nachhaltige Mobilität.
Wenn ein Unternehmen seinen Angestellten vorschreibt, wie sie zur Arbeit pendeln sollen, kann das schlecht ankommen. Wie packt man das Thema am besten an?
Vorbilder innerhalb des Unternehmens sind von grosser Bedeutung: Führungskräfte und engagierte Mitarbeitende, die nachhaltige Mobilität aktiv vorleben, können als Inspiration dienen und ihre Kolleginnen und Kollegen motivieren, ihr Mobilitätsverhalten ebenfalls umweltfreundlicher zu gestalten.
Für Unternehmen empfiehlt es sich, eine Kombination aus Pull- und Push-Massnahmen zu nutzen. Pull-Massnahmen setzen auf positive Anreize, beispielsweise durch die Förderung von Fahrgemeinschaften, Vergünstigungen für den öffentlichen Nahverkehr oder die kostenlose Nutzung von (E-)Bikes. Ergänzend dazu können Push-Massnahmen, wie etwa eine restriktive Vergabe von Parkplätzen ausschliesslich an Mitarbeitende mit langen Anfahrtswegen, das gewünschte Verhalten zusätzlich unterstützen. Das Pharmaunternehmen Roche macht dies zum Beispiel an seinem Firmenstandort in Basel. (Hinweis: Weitere Praxisbeispiele hier: Nachhaltig und energieeffizient unterwegs: Wie sumo Unternehmen vernetzt. | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie)
Das Projekt sumo wurde gewissermassen institutionalisiert. Es wurde eine neue Fachstelle für nachhaltige Mobilität in Unternehmen geschaffen. Ist das auch Ausdruck dafür, dass punkto nachhaltige Mobilität in Unternehmen noch viel zu tun ist?
Die Nachfrage am sumo Netzwerk mitzuwirken zeigte, dass es einen Bedarf gibt und Unternehmen die Mobilität nachhaltiger gestalten wollen.
Unternehmen können im Rahmen der Fachstelle kostenlose Kennenlerngespräche vereinbaren, im Innovationssprint an interaktiven Workshops oder Webinaren zu diversen Themen mitwirken oder in den Lösungs-Labs skalierbare Lösungen für die nachhaltige Mobilität entwickeln.
Mobilitätsmanagement ist keine punktuelle Aufgabe, sondern ein komplexer, langfristiger und lohnenswerter Prozess. Es gilt das Mobilitätskonzept periodisch zu optimieren, die Massnahmen im Unternehmen zu leben und zu verankern.
Link zur Fachstelle Nachhaltige Mobilität in Unternehmen:
https://www.energieschweiz.ch/mobilitaet/mobilitaet-in-unternehmen/
Sumo: https://www.energieschweiz.ch/mobilitaet/sumo/
Kontakt: fachstelle@nachhaltigemobilitaet.ch
Interview: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie




 1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00
1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Vom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz – Teil 9: Partizipation im Sachplanverfahren (Überblick)
«Ob in der Schweiz in der Entsorgungsfrage radioaktiver Abfälle […] faire, gerechte und ausgewogene Partizipation zur Anwendung gelangen [wird], wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Inwiefern alle Akteure dazu bereit sind, aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören und die unterschiedlichen Wertmassstäbe und Risikowahrnehmungen zu akzeptieren, wird sich zeigen.» So folgerte das BFE in einer breit angelegten Studie 2006. Darin untersucht wurden bereits gemachte Erfahrungen mit partizipativen Verfahren in der Entsorgungspolitik im In- und Ausland und formulierte Grundsätze für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Sachplanverfahren. Deshalb ist die Frage berechtigt: Konnten diese hohen Ansprüchen in der Realität umgesetzt werden? Weiterlesen




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenAuto, E-Trottinette oder auch Parkplatz. Rund 60 Anbieter von Shared Mobility-Angeboten gibt es in der Schweiz. Der Verband CHACOMO, die Swiss Alliance for Collaborative Mobility, vertritt viele dieser Anbieter. Das Ziel: Die kollaborative Mobilität zu fördern. Nach 2023 hat der Verband nun 2024 zum zweiten Mal den CHACOM-Oscar verliehen – an zwei Städte, die sich besonders für die geteilte Mobilität einsetzen. Was machen Luzern und Schaffhausen besser als andere? Und warum braucht es diese Auszeichnung? Weiterlesen




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenWhat are the best policy measures to decarbonise Switzerland? A stand-alone carbon tax? A combination of taxes, subsidies, bans and standards? The DECARB project explores these questions and shows the advantages of combining measures to reach climate neutrality.
Academics typically recommend the introduction of a carbon tax to shift the economy away from fossil fuels and mitigate climate change. However, this policy proposal usually faces strong opposition from industry and the public, even if the revenues are fully redistributed.
In the DECARB project, a team of researchers investigated whether the use of other measures such as subsidies, standards or bans could facilitate the decarbonisation of Switzerland to an extent compatible with its goal of climate neutrality by 2050. In particular, it looked at how combining these measures into „instrument mixes“ might be superior to using just one of them, including the carbon tax. Overall, its findings suggest that mixes offer significant potential to advance climate policy.
DECARB is a research project sponsored by the EES programme and coordinated by the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
The project addresses the colossal challenge of decarbonising the Swiss energy system, including transport, residential buildings, and industry. Given that individual policy measures all have shortcomings, the project investigates how mixes of measures could enhance climate policy. Thanks to a pluri-disciplinary approach, DECARB identifies desirable mixes that would allow Switzerland to reach climate neutrality by 2050.
First, a review of the academic literature shows that there are several market failures, barriers to decarbonisation and policy constraints that justify the use of instrument mixes rather than a stand-alone carbon tax. While the desirable mixes differ across sectors, given the different target actors and technologies, some carbon tax is found to play a key role in all of them.
Second, using a mathematical model of the Swiss economy, the researchers show that the deep decarbonisation induced by the mixes has a negligible impact on gross domestic product (GDP), in the order of 1‰. When complementary instruments are included in the policy landscape, the carbon tax rate required to achieve an ambitious emissions target can be divided by about two. On the other hand, a stand-alone carbon tax allows for the highest rebate to households among the scenarios considered.
Third, using an online survey, the team provides evidence that Swiss citizens have a strong preference for instrument mixes rather than a stand-alone carbon tax. Language region, number and type of cars owned, and perceived threat of climate change are found to be important predictors of instrument preferences.
Full report: Cocker, F., Thalmann, P., Vielle, M., Vöhringer, F., Weber, S. (2024). DECARB – Mixes of policy instruments for full decarbonisation by 2050. Project funded by the Energy-Economy-Society (EES) research programme of the Swiss Federal Office of Energy (SFOE), Bern.
Authors: Fleance Cocker (EPFL), Philippe Thalmann (EPFL)
Shutterstock: ID: 2463945033; Doidam 10




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenViel Beifall für die Watt d’Or-Gewinnerinnen 2025 an der Preisverleihung in Bern
Zum 18. Mal hat das Bundesamt für Energie am 9. Januar 2025 vor über 600 Akteurinnen und Akteuren aus der Energiebranche im Kursaal Bern den Watt d’Or verliehen. Analog zum diesjährigen Motto «Mondlandung» wurden Innovationen ausgezeichnet, die einen bedeutenden Beitrag zur Energiezukunft des Landes leisten können. Energeiaplus hat Reaktionen von Jury und Gewinnern nach der Preisverleihung zusammengetragen.
Kategorie Energietechnologien
Mit dem überschüssigen PV-Strom vom Sommer im Winter das Gebäude heizen? Ja, das geht. Mit einem thermochemischen Verfahren, dass die Hochschule Luzern zusammen mit der Firma Matica AG entwickelt hat, wird der Sommer-Strom gespeichert, indem Natronlauge das Wasser entzogen wird. Im Winter wird die Lauge wieder mit Wasser verdünnt, wobei Wärme entsteht.
Wie kommt man auf so eine Idee und was sagt die Jury dazu?
Kategorie Erneuerbare Energien
Aus 6’600 transparenten Panels besteht die Agri-PV Anlage auf dem Dach des neuen Gewächshauses der Lubera AG in Buchs (SG). Sie gehört dem Energieversorgungsunternehmen ewb und produziert im Jahr rund 750’000 kWh Strom.
Welche Bedeutung hat diese spezielle PV-Anlage für ewb?
Kategorie Mobilität
Die Galliker Transport AG hat eine innovative Lösung für das Aufladen seiner Elektrolastwagen gefunden. Die Ladeinfrastruktur mit 28 Ladestationen ist unterirdisch verstaut – in einem sogenannten Elektro-Power-Tunnel. Zugänglich ist sie durch Ladeluken im Boden.
Bewährt sich diese unterirdische Lösung? Was hat die Jury überzeugt an dieser Innovation?
Kategorie Gebäude und Raum
Man kann nicht nur Auto oder Bohrmaschine teilen, sondern auch die Heizung. Mit der Erdsonden-Wärmepumpe, die ein Basler Hausbesitzer in seinem Reiheneinfamilienhaus installierte, werden auch die Nachbarn mit Wärme versorgt. Unterstützt wurde das Projekt vom städtischen Energieversorger IWB.
Welches Potenzial haben solche Mini-Wärmeverbünde? Was ist innovativ an dieser Lösung?
Einen Spezialpreis vergab die Jury an vier Energieversorgungsunternehmen. Sie bieten Lösungen bei den Netztarifen an, die helfen sollen, dass das Stromnetz nicht zunehmend an den Anschlag kommt.
Was zeichnet diese Lösungen aus? Wie reagieren die Stromkundinnen und -kunden darauf?
Das Bundesamt für Energie gratuliert allen Gewinnern zu ihren Bestleistungen im Energiebereich. Die Videos zu den Siegerprojekten finden Sie hier:
Das Video zur Preisverleihung finden Sie hier.
In der Jury des Watt d’Or sind Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Forschung, Wirtschaft, Architektur, Fachverbänden und Umweltverbänden.
Der nächste Watt d’Or wird im Januar 2026 verliehen.
Brigitte Mader und Fabien Lüthi, Kommunikation, Bundesamt für Energie




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenStandortsuche Tiefenlager: Thomas Meyer über seine Zeit als Kulturgast
Der Schriftsteller und Künstler Thomas Meyer war der erste Kulturgast der Region Nördlich Lägern. Während sechs Monaten hat er sich in Form eines Blogs auf der Kulturgast-Webseite mit der Standortregion, dem geplanten geologischen Tiefenlager und den radioaktiven Abfällen auseinandergesetzt. Weiterlesen




 3 Vote(s), Durchschnitt: 3,67
3 Vote(s), Durchschnitt: 3,67Winter-Session 2024: Parlament debattiert über Energieforschung und Transparenz beim Energiehandel
In der Herbstsession waren sich National- und Ständerat noch uneins, wieviel Fördergelder die Erweiterung des Forschungsförderungsprogramm SWEET erhalten soll. Nun ist das Geschäft in der Wintersession 2024 nochmals traktandiert. Weitere Themen in der kommenden Session sind: Neue Regeln für mehr Transparenz beim Energiegrosshandel, Solidaritätsabkommen zur Gasversorgung und verschiedene Vorstösse aus dem Energiebereich. Weiterlesen




 1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00
1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt
Bundesamt für Energie
Pulverstrasse 13
3063 Ittigen
Postadresse:
Bundesamt für Energie
3003 Bern
Telefonnummern:
Hauszentrale +41 58 462 56 11
Pressestelle +41 58 460 81 52
Newsletter
Sitemap
 Medienmitteilungen des BFE
Medienmitteilungen des BFE
- Ein Fehler ist aufgetreten – der Feed funktioniert zurzeit nicht. Versuchen Sie es später noch einmal.
 BFE - Brigitte Mader
BFE - Brigitte Mader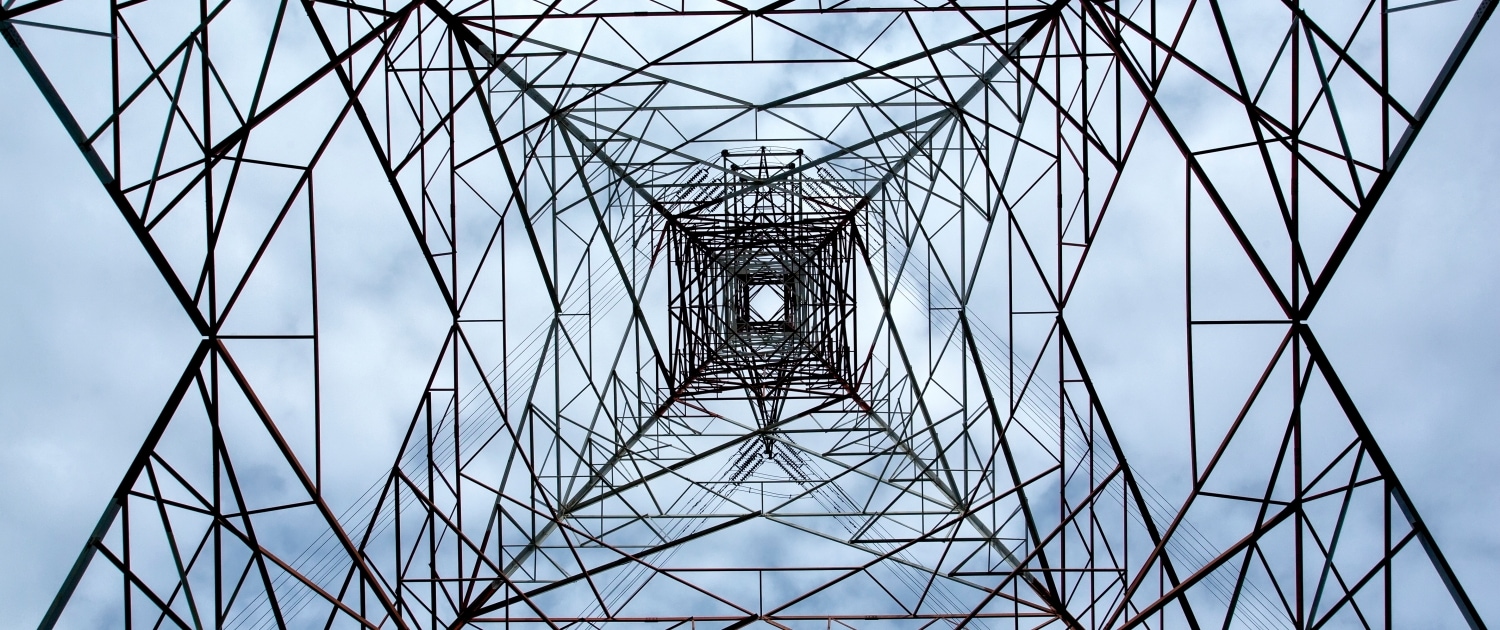 Shutterstock
Shutterstock Flughafen Zürich AG
Flughafen Zürich AG Screenshot BFE
Screenshot BFE BFE
BFE Keystone
Keystone shutterstock
shutterstock BFE
BFE Bild: Daniel Pochetti
Bild: Daniel Pochetti Parlamentsdienste 3003 Bern
Parlamentsdienste 3003 Bern