E-Bagger: Schluss mit CO2-Emissionen auf der Baustelle
Staub, Lärm und Abgase von Baumaschinen mit Dieselmotor: Das sind typische Begleiterscheinungen von Baustellen. Pilot-Baustellen in den Städten Basel, Zürich und Luzern sollen zeigen, dass es ruhiger und mit weniger CO2-Emissionen geht. Eingesetzt werden dabei unter anderem batterieelektrische Bagger. Die Entwicklung dieser E-Bagger hat das Bundesamt für Energie (BFE) im Rahmen des Pilot- und Demonstrationsprogramms unterstützt.
ZE150W: So heisst der elektrische Mobilbagger, der auf den Pilot-Baustellen in Basel und in Luzern im Einsatz steht. Dieser Bagger ist mit Rädern statt Raupen ausgestattet. Er ist damit flexibler einsetzbar als ein Raupenbagger und kann mit der entsprechenden Zulassung auf öffentlichen Strassen fahren und so verschiedene Baustellen verbinden.
Entwickelt wurde der Mobilbagger vom Schweizer Unternehmen SUNCAR, welches sich die letzten 10 Jahre auf die Elektrifizierung von Baumaschinen spezialisiert hat. Dabei baut SUNCAR die Bagger nicht von Grund auf neu, sondern plant, konstruiert und integriert elektrische Komponenten wie Batterien, Steuerungen und Ladeinfrastruktur in bestehende oder neue Maschinen – in diesem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Hitachi-Händler KTEG.

Der elektrische Bagger im Einsatz; Bild: SUNCAR
Warum hat das Bundesamt für Energie die Entwicklung des Mobilbaggers unterstützt? Wurden die Erwartungen erfüllt? Welche Herausforderungen stellten sich bei der Entwicklung des Rad-Baggers? Was sind die Erfahrungen damit? Energeiaplus hat bei Rik Bättig, Projektleiter bei SUNCAR, und Men Wirz, Leiter des Pilot- und Demonstrationsprogramms beim BFE nachgefragt.
Energeiaplus: Batterie statt Dieselmotor einsetzen und schon fährt der Bagger elektrisch: So einfach war die Entwicklung des Mobilbaggers vermutlich nicht. Was war die grösste Herausforderung bei der Entwicklung?
Rik Bättig: Es ging nicht einfach darum, den Dieselmotor durch eine Batterie und einen Elektromotor zu ersetzen, sondern es galt die Grenzen der weiterführenden Elektrifizierung auszuloten. Die grösste Herausforderung war, die ursprüngliche Maschine so gut zu verstehen, dass sie elektrisch nachgebaut und erweitert werden konnte – ohne dass der Fahrer einen Unterschied merkt. Dazu mussten alle Bereiche der Maschine angepasst werden: Hydraulik, Kabel, Kühlung und Steuerung. Weil es für Elektrobagger noch nicht alle nötigen Bauteile zu kaufen gibt, mussten einige Antriebssysteme komplett neu entwickelt werden.
Welchen Anforderungen muss ein solcher Bagger genügen?
Rik Bättig: Ein Elektrobagger muss im Alltag genau das leisten können, was ein herkömmlicher Dieselbagger kann, nur eben ganz ohne Abgase und etwas leiser. Das heisst:
- Kraft und Ausdauer: Er muss genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag haben, ohne zwischendurch lange laden zu müssen.
- Zuverlässigkeit: Auch bei Hitze, Kälte, Staub und Regen muss alles einwandfrei funktionieren.
- Präzise Steuerung: Der Fahrer soll die Maschine genauso feinfühlig und kraftvoll bedienen können wie gewohnt.
- Sicherheit: Ein Elektrobagger insbesondere die Batterien, fordern besondere Schutzvorkehrungen – um etwa die Gefahr eines Stromschlags zu erkennen, Überhitzung vorzubeugen und starke Erschütterungen zu dämpfen.
- Praxistaugliches Laden: Die Batterie muss sich einfach, schnell und sicher aufladen lassen. Idealerweise über die bestehende Infrastruktur auf der Baustelle.
Der Mobilbagger wurde auf einem Testgelände erprobt und mit dem dieselbetriebenen Modell direkt verglichen. Was ist das Fazit?

Rik Bättig ist stellvertrender Teamleiter bei SUNCAR. Bild SUNCAR
Rik Bättig: Das Fazit fällt sehr positiv aus: Der elektrische Mobilbagger konnte in den Tests deutlich effizienter arbeiten als das dieselbetriebene Vergleichsmodell. Alle Arbeiten auf der Baustelle können problemlos elektrisch erledigt werden. Im Gegensatz zum Dieselmodell, bei dem die Motorleistung auf verschiedene Funktionen verteilt wird, werden bei der elektrischen Variante einige Antriebe direkt elektrisch bewegt, was für extra Power sorgt. Das bedeutet: keine Leistungsverluste, gleichmässige Kraftentfaltung und effizientes Arbeiten. Zudem spart man mit dem Elektrobagger im Betrieb rund 60% der Energiekosten ein und verursacht beim Einsatz abhängig vom Strommix nur noch einen Bruchteil der Emissionen.
Der Mobilbagger wurde von Mitte August 2025 an für 8 Wochen auf der Baustelle in der Stadt Basel genutzt. Basel will, dass Baustellen auf Stadtgebiet künftig elektrisch sind, um einerseits CO2-Emissionen zu vermeiden, aber auch Lärm. In einem Medienbericht hiess es, dass es den Anwohnerinnen und Anwohnern in Basel nichts gebracht hat. Was sagen Sie dazu?
Rik Bättig: Hier muss ganz klar differenziert werden: Eine Baustelle bleibt auch mit elektrischen Maschinen laut – etwa beim Aufbrechen von Asphalt oder beim Bewegen von Material. Diese Geräusche entstehen unabhängig vom Antrieb. Jedoch entsteht am Elektrobagger kein Motorenlärm und das anhaltende Brummen im Leerlauf fällt weg, weil der elektrische Antrieb dann einfach zum Stillstand kommt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass laute Arbeiten laut bleiben, jedoch dazwischen der Grundpegel des Dieselmotors ausbleibt. Das macht einen deutlichen Unterschied, besonders in dicht bewohnten Gebieten.
Zudem fallen Dieselgeruch und Schadstoffe komplett weg, was die Luftqualität in dicht besiedeltem Raum verbessert. Das zeigt sich zwar weniger unmittelbar als Lärm, ist aber ein klarer Vorteil für Anwohnerinnen und Anwohner und fürs Klima.
Die Baustelle in Basel ist ein Pilotprojekt, welches genau solche Effekte erörtert und direkte Vergleichsmessungen durchführt. So lässt sich schlussendlich fundiert und objektiv eine Aussage zu den Unterschieden treffen, wo Elektromaschinen bereits Verbesserungen bringen und wo noch weiteres Potenzial besteht.
Wo könnten die Elektrobagger sonst noch zum Einsatz kommen ausser auf Baustellen in Städten? Auch auf Grossbaustellen zum Beispiel?
Rik Bättig: Ja, auf jeden Fall! Das Potenzial geht weit über städtische Baustellen hinaus. Elektrobagger eignen sich überall dort, wo Lärm, Abgase oder strenge Umweltauflagen eine Rolle spielen, also zum Beispiel:
- auf Tunnel- und Innenbaustellen, wo Abgase nicht entweichen können,
- in Wohngebieten, bei Spitälern oder in Schulnähe, wo Ruhe gefragt ist,
- bei Nachtarbeiten, welche strengen Lärmvorschriften folgen müssen
- und mit entsprechender Ladeinfrastruktur auch auf Grossbaustellen oder Infrastrukturprojekten, etwa beim Strassen- oder Bahnbau.
Langfristig könnten elektrische Baumaschinen überall dort zum Standard werden, wo nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz und Klimaschutz gefragt sind.
Das Bundesamt für Energie hat das Projekt unterstützt. Warum?

Men Wirz leitet beim BFE das Pilot- und Demonstrationsprogramm. Bild: BFE – Jan Holger Engberg
Men Wirz: Das Projekt hat 2021 im Rahmen einer Projektausschreibung zum Thema Markterprobung von elektrischen Fahrzeugen und Maschinen den Zuschlag für eine Förderung erhalten, neben sechs weiteren Projekten. Das Ziel der Ausschreibung war es, innovative elektrische Alternativen für Anwendungsbereiche auf den Markt zu bringen, wo es noch keine Lösungen gab, aber eine Nachfrage dafür besteht. Mit der Förderung sollen die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen bei der Umstellung von fossilen Treibstoffen auf elektrische Systeme reduziert werden.
Das Projekt von SUNCAR hat genau dort angesetzt: ein mobiler Bagger in einer Gewichtsklasse zu entwickeln, für die es zu dieser Zeit noch keine kommerziellen Produkte am Markt gab. SUNCAR hat zudem einige sehr innovative technische Lösungen entwickelt, wie den hydroelektrischen Antrieb, der effizienter ist als normale hydraulische Antriebe und eine Rückgewinnung von Bremsenergie ermöglicht.
Wurden die Erwartungen erfüllt?
Men Wirz: Die Realisierung eines neuen, kommerziell einsetzbaren elektrischen Baggers stellt nach wie vor eine grosse technische Herausforderung dar, selbst wenn man vorher bereits ähnliche Maschinen gebaut hat. Dies umso mehr, als dass hier noch ein neuer Antrieb entwickelt wurde, zu dem es bisher nicht wirklich Erfahrungen gibt. Und schliesslich bleibt am Ende noch ein kommerzielles Risiko übrig, selbst wenn das Fahrzeug einwandfrei funktioniert. In Anbetracht dieser Herausforderungen hat das Projekt unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Die beiden Prototypen und die neuen innovativen Komponenten funktionieren gut, die technischen Werte im Einsatz sind sehr zufriedenstellend, und es gibt ein reges Interesse an dieser Lösung in der Praxis, wie die neuen e-Baustellen-Projekte (siehe Kasten) zeigen.
Was braucht es, damit elektrische Baumaschinen definitiv die Baustellen erobern?
Men Wirz: Was aus meiner Sicht weiterhin offen bleibt, ist die Aufskalierung der Produktion solcher Lösungen, auch um die Kosten weiter zu reduzieren und die Marktdurchdringung zu erhöhen. Die Zusammenarbeit von SUNCAR mit einem grossen, etablierten Maschinenproduzent bietet diesbezüglich günstige Voraussetzungen, dass dies klappt.
Rik Bättig: Damit elektrische Baumaschinen in der Schweiz flächendeckend zum Einsatz kommen, braucht es ein gemeinsames Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Forschung. Aus unserer Sicht müssten Rahmenbedingungen und Förderprogramme, wie das Pilot- und Demonstrationsprogramm des Bundesamts für Energie (BFE), weitergeführt und ausgebaut werden. Sie helfen, neue Technologien zu testen, Erfahrungen zu sammeln und Kosten zu senken. Andererseits braucht es Investitionen in die Ladeinfrastruktur auf Baustellen und klare Vorgaben in öffentlichen Ausschreibungen, damit der Einsatz emissionsfreier Maschinen zum neuen Standard wird. Wenn Politik, Verwaltung und Bauwirtschaft gemeinsam vorangehen, kann die Schweiz zeigen, dass klimafreundliches Bauen nicht Zukunftsvision, sondern gelebte Praxis ist.
Wenn der Bagger summt statt brummt: Pilotprojekt E-Baustelle
Bis 2037 sollen möglichst alle Baustellen in Basel-Stadt lokal CO2-emissionsfrei sein. Mit dem Neubau der unterirdischen Wertstoffsammelstelle in der Hegenheimerstrasse testet der Kanton Basel-Stadt die Umsetzung einer elektrifizierten Baustelle. Als Referenz dient ein vergleichbares Projekt, das mit konventionellen Baumaschinen umgesetzt wurde.
Auch die Stadt Zürich nutzt in einem Pilotprojekt elektrische Baustellenfahrzeuge beim Umbau einer Turnhalle in eine Tagesschul-Einrichtung. Die Erfahrungen zeigen, dass die Baumeisterarbeiten, die den Einsatz von Bagger, Dumper und Radlader sowie umfassende Materialzulieferungen und Abfuhr erfordern, mit elektrifizierten Maschinen durchgeführt werden können.
Die Stadt Luzern will ab 2040 für stadteigene Baustellen nur noch Maschinen und Fahrzeuge mit erneuerbarem Antrieb einsetzen. Erprobt wird das beim Bau von neuen Halteplätzen für Reise- und Ausflugsbusse in der Stadt Luzern.
Interview: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie
Bild: SUNCAR
 SUNCAR
SUNCAR
 IStockEine digitale Datendrehscheibe für die Transformation des Schweizer Energiesektors
IStockEine digitale Datendrehscheibe für die Transformation des Schweizer Energiesektors  Graue Energie ist versteckte Energie
Graue Energie ist versteckte Energie 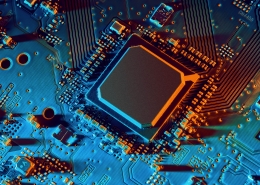 ShutterstockWie der Strom effizienter umgewandelt werden kann
ShutterstockWie der Strom effizienter umgewandelt werden kann 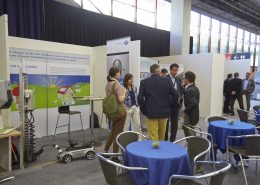 Energie-Tage St. Gallen
Energie-Tage St. Gallen 
 keystone-sda
keystone-sda Jérémy Toma
Jérémy Toma
Neuste Kommentare