Das Schweizer Energiesystem für künftige Risiken wappnen
Wie stark Wirtschaft und Gesellschaft von der Energieversorgung abhängig sind, hat das Blackout Ende April auf der spanischen Halbinsel gezeigt. Eine Energieinfrastruktur, die auf künftige Gefahren vorbereitet ist und Menschen, die mit kritischen Situationen umgehen können, sind deshalb von grosser Bedeutung. Diesen Herausforderungen widmet sich das neue SWEET-Konsortium RECIPE (Resilient Infrastructure for the Swiss Energy Transition). Welche Gefahren dabei im Fokus stehen, welche Rolle die Cyber-Sicherheit spielt und wie die Forschenden diese Fragen konkret angehen wollen, erläutert Giovanni Sansavini, Koordinator des RECIPE-Konsortiums im Interview.
Energeiaplus: Eine Strommangellage oder ein Blackout gehören gemäss Risikobericht des Bundes zu den Top-Risiken für die Schweiz. Stehen diese auch bei RECIPE im Vordergrund?

Giovanni Sansavini koordiniert das SWEET-Konsortium RECIPE. Bild: D-MAVT / ETH Zürich / Ramona Tollardo
Giovanni Sansavini: Diese Risiken sind sicher zentral, zumal die Energieversorgung immer stärker von der Elektrizität abhängt. Wir fragen uns einerseits, wie es zu solchen Ereignissen kommen kann. Andererseits analysieren wir, was danach passiert. Wie wirkt sich eine Strommangellage auf Gesellschaft, Wirtschaft und natürliche Ressourcen aus? Welche Kaskadeneffekte treten auf? Wir gehen also weit über technische Risikoanalysen hinaus. Unser Konsortium vereint deshalb auch unterschiedlichste Disziplinen vom Ingenieurswesen über Klimaforschung bis zur Ökonomie und Psychologie.
Wie gehen Sie vor?
Das Konsortium RECIPE wendet ein klassisches Risikobewertungsmodell auf das Schweizer Energiesystem an. Wir analysieren potenzielle Gefahren. Wir untersuchen weiter, wie exponiert die Energieinfrastrukturen gegenüber diesen Gefahren sind. Und schliesslich beurteilen wir, welche Konsequenzen das Eintreten eines Vorfalls hätte und wie systemrelevant diese Konsequenzen wären.
Sie untersuchen, wie sich der Umbau des Energiesystems, der Klimawandel und Cyber-Risiken auf die Energieinfrastruktur auswirken könnten. Wo liegen die wichtigsten Gefahren?
Aktuell arbeiten wir an der Gefahrenanalyse. Wir berücksichtigen breit gefächerte Aspekte: Naturgefahren wie Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und extreme Kälte; technische Ausfälle z.B. durch Transformatordefekte oder weil die zur Verfügung stehenden Technologien nicht konsequent eingesetzt werden; oder cyber-physische Risiken wie Malware oder verdeckte Hintertüren in Hardware. Auch sozio-politische Risiken wie politische Unsicherheit oder das Fehlen internationaler Abkommen analysieren wir.
Inwiefern wirken sich die Folgen des Klimawandels auf die Energieinfrastruktur aus?
Im Fokus stehen klimabedingte Produktionsausfälle. Heisse und trockene Bedingungen beeinträchtigen sowohl die Verfügbarkeit der Wasserkraft als auch die Kühlkapazität von Kernkraftwerken. Hitze kann auch zum Ausfall von technischen Komponenten führen. Überschwemmungen können durch Treibgut oder Geschiebe Infrastrukturen beschädigen oder die Anlagenbetreiber dazu zwingen, die Turbinen auszuschalten. Letztendlich wollen wir verstehen, inwieweit das Schweizer System anfällig ist für diese Risiken und ob sich finanzielle Investitionen für Gemeinden und die Wirtschaft lohnen, um sie einzudämmen.
Cyber-Risiken gewinnen zunehmend an Bedeutung. Welche Bedrohungen stehen im Fokus?
Wir betrachten Cyber-Bedrohungen aus zwei Perspektiven: gezielte Angriffe und technologische Umbrüche. Gezielte Angriffe können etwa durch Malware oder manipulierbare importierte Hardware erfolgen. Zum Beispiel könnten Router mit versteckten Schwachstellen ein Einfallstor bieten. Gleichzeitig beobachten wir technologische Entwicklungen wie Quantencomputer, die künftig heutige Verschlüsselung knacken könnten. Systeme, die bislang als sicher gelten, würden damit schlagartig verwundbar. Solche disruptiven Entwicklungen beobachten wir sehr genau.
Eine viel diskutierte Gefahr für unsere Energieinfrastruktur haben Sie noch gar nicht erwähnt: Die Destabilisierung des Stromnetzes durch unregelmässiges Einspeisen von erneuerbaren Energien.
Dieses Thema steht auch im Zentrum unserer Forschung. Aber die meisten Ursachen des Problems sind bereits bekannt, und wir kennen die Möglichkeiten, diese Instabilität bis zu einem bestimmten Grad zu reduzieren. Es braucht hier nicht weitere Technologien, wir müssen sie einfach in unsere Abläufe integrieren und besser nutzen. Damit will ich dieses Risiko nicht herunterspielen, es ist präsent und relevant.
Der Umbau des Energiesystems kann aber auch noch andere Risiken mit sich bringen. Wenn die Schweiz beispielsweise auf Photovoltaikanlagen in den Alpen setzt, besteht aufgrund der Lage in den Bergen ein erhöhtes Risiko für Schäden durch Naturgefahren.
Wie können wir Risiken erkennen, die wir heute vielleicht gar noch nicht erahnen?
Wir nutzen moderne KI-Instrumente, um Schwachstellen im System aktiv zu erkennen. In diesem Fall gehen wir nicht von der Gefahr aus und fragen, welche Folgen diese für das System haben könnte, sondern wir beginnen mit dem System selbst und versuchen zu verstehen, welche Art von Schäden und welche Kombination von Schäden am kritischsten sind: Was sind die bedeutendsten denkbaren Auswirkungen? Dann gehen wir zurück und überlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Schäden tatsächlich eintreten werden.
Wie lässt sich Resilienz im Energiesystem aufbauen?
Das ist der Kern von RECIPE. Resilienz heisst nicht nur robuster werden, sondern auch gezielt zwischen Robustheit und Wiederherstellungsfähigkeit abzuwägen. Wir stellen Fragen wie: Soll ein Systemteil ausfallsicher gemacht werden oder planen wir besser für eine schnelle Reparatur? Transformatoren etwa brauchen Monate zur Beschaffung – da ist Robustheit zentral. Bei Hochwasser wiederum könnte eine schnelle Wiederherstellung sinnvoller sein als teure Prävention. Eine kluge Resilienzstrategie passt die Massnahmen den jeweiligen Risiken an. Wir sollten so weit wie möglich besser investieren und nicht unbedingt mehr, um Resilienz zu erreichen.
Entscheidend ist auch die Häufigkeit der Ereignisse. Wenn zum Beispiel Hochwasserereignisse nur alle 50 Jahre auftreten, kann sich eine rasche Wiederherstellung lohnen. Tritt ein Schaden jedoch fast jährlich auf, ist eine robuste Vorsorge ökonomisch sinnvoller. Wir kooperieren dazu mit dem National Centre for Climate Services (NCCS), das Klimaprojektionen für die Schweiz erarbeitet.
Eingangs haben Sie erwähnt, dass RECIPE auch die Folgen auf Wirtschaft und Gesellschaft untersucht – z.B. die Auswirkungen einer Strommangellage.
Genau, unsere Wirkungsanalyse endet nicht beim Stromnetz, sondern erfasst auch die Auswirkungen auf Gemeinden, Wirtschaft und Umwelt.
Strommangel kann Preisexplosionen auslösen und Bevölkerung und Industrie spürbar treffen. Blackouts stören essenzielle Dienste und führen zu massiven wirtschaftlichen Verlusten und Notlagen, bis hin zu Auswirkungen auf Menschenleben. Wir arbeiten mit Ökonominnen und Sozialwissenschaftlern, um die Verwundbarkeit von Unternehmen zu verstehen, und mit Sozialwissenschaftlern, um das Verhalten und die Akzeptanz der Bevölkerung zu erforschen.
Ein wichtiges Anliegen von RECIPE ist der Praxistransfer. Mit welchen Partnern arbeiten Sie zusammen?
Unser Ziel ist es nicht, Lösungen vorzugeben, sondern unsere Erkenntnisse als Grundlagen für fundierte Diskussionen zur Verfügung zu stellen. Wir sind dazu im Austausch mit kantonalen Zivilschutzstellen, Energieversorgern und KMU. Gerade Kantone sind zentrale Partner. Sie kennen die Realitäten vor Ort. Ihre Einbindung stellt sicher, dass unsere Ergebnisse für Risikostrategien, Notfallpläne und Investitionen konkret nutzbar werden.
Und mit der Politik?
Politische Entscheide basieren immer auch auf Werten und gesellschaftlichen Perspektiven, nicht nur auf Zahlen. Auch hier geben wir keine fertigen Handlungsempfehlungen ab. Vielmehr wollen wir Narrative entwickeln und gemeinsam mit Entscheidungsträgern Szenarien analysieren und Massnahmen abwägen.
Ziel ist, Ressourcen gezielt und effizient einzusetzen. Denn nicht alles kann gegen alles geschützt werden – aber vieles kann so geplant werden, dass eine rasche Rückkehr zur Funktionsfähigkeit möglich ist. Letztlich geht es dabei immer auch um gesellschaftliche Entscheidungen. Manche Standorte werden wir besser schützen, andere vielleicht aufgeben. RECIPE liefert nicht die Antworten – aber die Grundlagen für eine offene und fundierte Diskussion.
SWEET – «SWiss Energy research for the Energy Transition» – ist ein Förderprogramm des Bundesamtes für Energie (BFE). Ziel von SWEET ist es, Innovationen zu fördern, die wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung der Energiestrategie 2050 und zur Erreichung der Klimaziele der Schweiz beitragen
Interview: Irene Bättig, Sprachwerk GmbH im Auftrag der Geschäftsstelle SWEET, Bundesamt für Energie (BFE)
 Shutterstock
Shutterstock
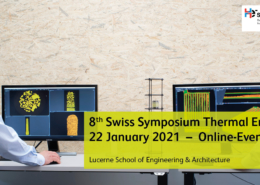 HSLU8th Swiss Symposium Thermal Energy Storage
HSLU8th Swiss Symposium Thermal Energy Storage  AMAGWie Karrosserie- und Lackierbetriebe Betriebe Richtung Netto-Null steuern können
AMAGWie Karrosserie- und Lackierbetriebe Betriebe Richtung Netto-Null steuern können  Billiger, sparsamer, moderner: 125 Jahre Werbung für das Heizen
Billiger, sparsamer, moderner: 125 Jahre Werbung für das Heizen  BFEDer Marathon ist zu Ende
BFEDer Marathon ist zu Ende 
 BFE
BFE
Neuste Kommentare