CHACOM-Oscar: Mehr Fahrt für geteilte Mobilität
Auto, E-Trottinette oder auch Parkplatz. Rund 60 Anbieter von Shared Mobility-Angeboten gibt es in der Schweiz. Der Verband CHACOMO, die Swiss Alliance for Collaborative Mobility, vertritt viele dieser Anbieter. Das Ziel: Die kollaborative Mobilität zu fördern. Nach 2023 hat der Verband nun 2024 zum zweiten Mal den CHACOM-Oscar verliehen – an zwei Städte, die sich besonders für die geteilte Mobilität einsetzen. Was machen Luzern und Schaffhausen besser als andere? Und warum braucht es diese Auszeichnung?
Carsharing fängt beim Bauen an:
Wer in der Stadt Luzern bei Bauprojekten Carsharing-Parkplätze vorsieht, kann im Gegenzug die Zahl der Pflichtparkplätze reduzieren. So hat es Luzern im städtischen Parkplatzreglement festgelegt. Konkret ersetzt ein Parkplatz für Carsharing vier Parkplätze für Privatautos. Luzern will Bauherrschaften so motivieren, das Carsharing als Alternative zum Privatauto gezielt zu fördern. Als Nachweis muss beim Einreichen des Baugesuchs ein Vertrag mit einer Carsharing-Organisation vorgelegt werden. Das Parkplatzreglement ist seit 2021 in Kraft. Ein erstes Projekt wird derzeit auf einem ehemaligen Industrie- und Gewerbeareal realisiert. 151 Wohnungen in 12 Häusern, vom Studio bis zur 12-Zimmer Wohnung sollen dort gebaut werden.
Weitere Projekte sind derzeit in Luzern nicht in Planung. Warum? David Walter, Projektleiter Mobilität bei der Stadt Luzern sagt: «Das Reglement ist noch nicht lange in Kraft. Es benötigt noch etwas Zeit, bis die neuen Möglichkeiten bei der Planung von Projekten berücksichtigt werden.» Und er vermutet, dass es auch mit längeren Planungszeiten zum Beispiel bei grösseren Arealentwicklungen zu tun hat. Das mediale Echo nach dem CHACOM Oscar könne aber sicher helfen, dass sich ein Bewusstsein für eine effiziente und nachhaltige Parkraumgestaltung entwickelt. Und auch darauf aufmerksam machen, dass es diese Möglichkeit gibt.
Von Schaffhausen zu Sharehausen:
Sharing-Angebote gab es in Schaffhausen zwar schon seit längerem, doch im Vergleich mit anderen Städten wurde noch Potenzial identifiziert. Im Rahmen von Testbetrieben in den Jahren 2023/2024 lancierte die Stadt Schaffhausen darum eine Sharing-Offensive und machte ihren Bürgerinnen und Bürgern drei verschiedene Sharing-Angebote:
Kostenlose Carsharing-Testabos, einen günstigen elektrischen Kleintransporter zum Teilen und zum ersten Mal wurden auf Stadtgebiet E-Scooter und E-Bikes zur Verfügung gestellt. Nach positiven Rückmeldungen wurde das Angebot noch in der Testphase bereits auf Nachbargemeinden ausgeweitet. Ab Frühling 2025 werden die E-Scooter dann im Rahmen eines dauerhaften Betriebs angeboten. «Die Stadt Schaffhausen hat damit geteilte Mobilität definitiv ins Rollen bringen können und prüft weitere Entwicklungen», sagt Ramon Göldi, Leiter «Smart City» Schaffhausen.
Der Verband CHACOMO hat 2024 den CHACOM-Oscar zum zweiten Mal verliehen. Warum braucht es diese Auszeichnung? Das wollte energeiaplus von Mathias Halef, stellvertretender Geschäftsführer des Verbands, wissen.
Energeiaplus: In den grossen Städten Bern und Zürich ist Shared Mobility bereits gut etabliert. Braucht es diesen CHACOM-Oscar überhaupt?
Mathias Halef: Mit dem CHACOM-Oscar möchten wir wegweisende Projekte öffentlichkeitswirksam bekannt machen, Anerkennung und Motivation schaffen und die Öffentlichkeit und Politik sensibilisieren. Ziel ist es, die Bedeutung der Förderung geteilter Mobilität in den Fokus zu rücken und weitere Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu inspirieren, solche Konzepte zu unterstützen. Zudem sollen dadurch Impulse für weitere Interessierte – zum Beispiel aus der Stadtentwicklung, Raumplanung oder von Transportunternehmenm Bereich der geteilten Mobilität gegeben werden. Auch Städte wie Bern und Zürich haben weiterhin Entwicklungspotenzial, um die kollaborative Mobilität zu fördern.
Der CHACOM-Oscar ist Teil des Programms «Shared Mobility Accelerator”. Der Hauptfokus liegt auf der Schaffung von Planungsgrundlagen sowie auf der Umsetzung von Massnahmen zur Steigerung der Akzeptanz der Shared Mobility in der breiten Bevölkerung. Das Programm läuft seit Juli 2023 bis Dezember 2025 und wird von EnergieSchweiz unterstützt.
Wer kann einen CHACOM-Oscar gewinnen? Und: Welche Kriterien müssen erfüllt sein?
Der CHACOM-Oscar wird an Gemeinden, Städte, Kantone oder Regionen verliehen, die nominiert worden sind. Nominieren können alle, die sich für das Thema interessieren. Eine Jury wählt schliesslich die Gewinner aus. Dabei kann es sich um Engagements in verschiedenen Bereichen handeln:
- Entwicklung von beispielhaften Regulatorien und Rahmenbedingungen (siehe das Beispiel Luzern)
- Zukunftsweisende Integration in kommunale Mobilitätsstrategien und -konzepte
- Umsetzung innovativer Pilotprojekte und Kollaborationen (siehe das Beispiel Schaffhausen)
- Entwicklung gezielter Fördermassnahmen zur Steigerung der Akzeptanz
- Kampagnen und Kommunikationsmassnahmen mit Multiplikationspotenzial
- Investitionen in den Ausbau von Infrastrukturen für die Shared Mobility
Die Jury, bestehend aus dem CHACOMO-Vorstand und Vertreterinnen und Vertretern des BFE diskutiert die Eingaben und beurteilt sie. Bei der Beurteilung stehen folgende drei Kriterien im Vordergrund:
- Innovative Vorgehensweise: Werden mit der Massnahme/dem Projekt neuartige und weitestgehend unerprobte Ansätze verfolgt, um die geteilte Mobilität zu fördern?
- Nationale Skalierbarkeit: Dient die Massnahme/das Projekt weiteren Gebietskörperschaften als Vorbild und kann sie andernorts gut angewendet und umgesetzt werden?
- Nachhaltige Wirkung: Wie gross ist die Wirkung in Bezug auf die Ziele der Shared Mobility Agenda 2030 (systemische Integration, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit)?

Mathias Halef ist stellvertretender Geschäftsführer des Verbands CHACOMO. Bild: Mobilitätsakademie des TCS
Heute nutzen knapp eine halbe Million Menschen in der Schweiz Carsharing. Bis 2030 soll es eine Million sein.
Aktuell stehen den rund 500’000 Carsharing-Nutzenden in der Schweiz etwa 10’000 geteilte Autos von spezialisierten Flottenbetreibern und Plattformen, wo Private ihr Fahrzeug zum Teilen anbieten, zur Verfügung. Aus Sicht der Branche scheint es sinnvoll und realistisch, bis 2030 mindestens eine Million Carsharing-Nutzende anzustreben, was ein Gesamtangebot von rund 20’000 geteilten Fahrzeugen erfordern würde. Gemäss Erkenntnissen aus einer Studie, welche von Mobility Carsharing in Auftrag gegeben wurde, würde eine solche Anzahl geteilter Fahrzeuge geschätzt 360’000 Privatfahrzeuge ersetzen. Das ist ein Anteil von immerhin 7.5 % des heutigen Gesamtbestands an Personenwagen im Privatbesitz in der Schweiz. Dadurch könnten gleich viele Parkplätze eingespart werden – grundsätzlich sogar mehr, da sowohl am Ausgangs- als auch am Zielort ein Parkplatz eingespart wird. Die durch die ersetzten Privatautos frei werdende Fläche beträgt 4’500’000 Quadratmeter, was 630 Fussballfeldern entspricht. Diese Zahlen veranschaulichen das enorme Potenzial, besonders im Hinblick auf eine Umnutzung des begrenzten Stadtraums. Das Beispiel des Parkplatzreglements in Luzern zeigt, wie das in der Praxis umgesetzt werden kann.
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen?
Das Ziel ist, ein flächendeckendes und zugängliches Sharing-Angebot. Die grösste Herausforderung dabei: die notwendige Infrastruktur bereitzustellen beispielsweise Ladestationen für E-Autos, die geteilt werden. Zusätzlich gilt es, die Akzeptanz von potenziellen Nutzenden zu erhöhen, vor allem bei jenen, die noch am Besitz eines eigenen Fahrzeugs oder Zweitwagens festhalten. Weiter ist es zentral, Anreize zu schaffen und Hemmschwellen abzubauen, beispielsweise, was die Verfügbarkeit der Fahrzeuge betrifft.
Darüber hinaus ist eine enge Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand, Anbietern und Nutzenden entscheidend, ebenso wie die Überwindung technologischer Hürden und die Integration verschiedener Plattformen in bestehende Systeme. Finanzierungsprobleme für Angebote ausserhalb des urbanen Raums erschweren das Wachstum weiter. Ein weitere Hürde ist die unzureichende Vernetzung zwischen den verschiedenen Shared Mobility-Angeboten, was dazu führt, dass das Potenzial nicht voll ausgeschöpft werden kann.
CHACOMO setzt sich dafür ein, Shared Mobility als einheitliches Ökosystem zu betrachten, das den öffentlichen Verkehr ergänzt und Ineffizienzen im Individualverkehr reduziert. Damit sich die geteilte Mobilität weiter etablieren kann, müssen diese Herausforderungen überwunden und Lösungen für eine bessere Integration gefunden werden. In diesem Zusammenhang unterstützt CHACOMO auch einen Vorstoss aus dem Nationalrat, der den Abbau regulatorischer Hürden zur Förderung der weiteren Marktentwicklung von Shared Mobility vorsieht.
Interview/Text: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie
Bild: Keystone – Michael Buholzer
 Keystone
Keystone
 Effiziente Elektrogeräte auch für Mieterinnen und Mieter
Effiziente Elektrogeräte auch für Mieterinnen und Mieter  Florian RüschDe nouvelles idées pour plus de biogaz
Florian RüschDe nouvelles idées pour plus de biogaz 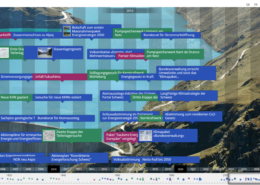 BFEMit der Energy-Timeline durch die Jahrhunderte
BFEMit der Energy-Timeline durch die Jahrhunderte  ShutterstockAktuelle Bauratgeber von EnergieSchweiz
ShutterstockAktuelle Bauratgeber von EnergieSchweiz 
 Keystone - Gaetan Bally
Keystone - Gaetan Bally BFE . Brigitte Mader
BFE . Brigitte Mader
Neuste Kommentare