Warum es Sinn macht, die Heizung vor dem Ersatz zu optimieren
Ölheizung raus, Wärmepumpe rein: Und schon wird erneuerbar geheizt. So weit, so gut. Doch: Leistet die neue Heizung genug, oder würde es auch eine Heizung mit weniger Leistung tun? Eine Studie im Auftrag von EnergieSchweiz zeigt: Es lohnt sich, bereits vor dem Ersatz die alte Heizung zu optimieren, um die notwendige Leistung der neuen Heizung richtig zu bestimmen.
Der Schlüssel zum Optimieren der Heizung ist ein intelligentes Ventil. Es wird bei der Heizverteilung angebracht, also dort, wo das Heizwasser in das Gebäude geleitet wird. Und so funktioniert das intelligente Ventil: Das Ventil lässt je nach Bedarf eine bestimmte Menge Wasser durch – analog zur Brause beim Gartenschlauch. Aber nicht nur das: Das Ventil misst und reguliert auch die Wassertemperatur.
In vier grösseren Mehrfamilienhäusern (MFH) – je zwei in Zürich und Genf – wurden solche intelligenten Ventile installiert. In einem Mehrfamilienhaus hat es in der Regel mehrere Abgänge – zum Beispiel einen für die Nordseite, einen für die Südseite des Gebäudes. Die Ventile wurden jeweils in den Rücklaufrohren montiert, durch die das Heizwasser nach dem Durchlaufen durchs Gebäude zurückfliesst (siehe Foto unten)

Bei der Heizverteilung an der Zweierstrasse in Zürich wurden drei intelligente Ventile angebracht (orange). Bild: Lemon Consult AG
Während der Heizperiode 2023/24 wurden Messungen durchgeführt. Gemessen wurde in einem ersten Schritt von Oktober bis Januar die Vorlauftemperatur (Heizwasser, bevor es ins Gebäude gelangt) und die Rücklauftemperatur (Heizwasser nach dem Heizvorgang in den Räumen) und auch die Wassermenge. Es zeigte sich Optimierungspotenzial, denn die Vorlauf- und Rücklauftemperatur waren fast gleich hoch. Oder anders gesagt: Beim Einleiten ins Gebäude wurde das Wasser zu stark aufgeheizt, eine tiefere Vorlauftemperatur oder/und eine geringere Wassermenge würde genügen.
Im zweiten Schritt wurde ab Januar dann die Optimierungsfunktion des Regulierventils aktiviert. Konkret wurde die Wassermenge dem Bedarf angepasst. Dabei gilt: Je kälter die Aussentemperatur, desto mehr Heizwasser wird in die Heizrohre geleitet. Das Ziel ist aber, dass nicht zu viel warmes Wasser in den Leitungen fliesst. Das wäre ineffizient. Bei den vier Testobjekten zeigte sich, dass die Regulierung der Wassermenge und die Senkung der Wassertemperatur keine Komforteinbusse für die Bewohnenden zur Folge hatte.
Die ist eine wichtige Erkenntnis für die Ausgestaltung der neuen Heizung. Konkret zeigte sich, dass die neue Heizung je nach Testobjekt um 12 bis 30% kleiner dimensioniert werden kann. Das bedeutet auch tiefere Investitionskosten bei der neuen Heizung. Und nicht nur das: Auch die bestehende Heizung kann bis zum Ersatz mit weniger Energieaufwand betrieben werden.
Es lässt sich also einiges rausholen, wenn die Heizung richtig reguliert ist. Doch: Warum brauchte es überhaupt eine solche Untersuchung? Werden Heizungen grundsätzlich zu gross ausgelegt? Und: Lassen sich diese Erkenntnisse auch auf andere MFH übertragen?
Energeiaplus hat bei Martin Mühlebach, Co-CEO des Beratungs- und Planungsunternehmen für Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz Lemon Consult AG und Mitautor der Studie nachgefragt.
Energeiaplus: Dass eine Heizung nur so viel leisten soll wie nötig, scheint plausibel. Warum ist es besonders bei erneuerbaren Heizsystem wichtig, dass die Heizung auf den Heizbedarf abgestimmt ist?

Martin Mühlebach ist Co-CEO bei Lemon Consult und Mitautor der Studie „Vorgezogener Heizgruppenersatz“.
Martin Mühlebach: Bei Öl- und Gasheizungen wurde weniger auf das optimale Einstellen der Heizung geachtet. Der Grund: Eine fossile Heizung mit mehr Leistung kostet nicht wesentlich mehr. Zudem kann die Raumtemperatur auch gewährleistet werden, wenn die Wassermenge und die Heizkurve nicht optimal reguliert sind.
Das ist bei erneuerbaren Heizsystemen anders. Insbesondere bei Wärmepumpen ist es wichtig, dass sie dem Bedarf entsprechend dimensioniert sind. Die neue Heizung wird im Normalfall anhand von Verbrauchsmessungen der bestehenden Anlage ausgelegt. Wenn die Anlage aber mangelhaft einreguliert ist, wird die neue Heizung zu gross eingebaut. Dies verursacht Kosten und Ineffizienzen, welche eingespart werden könnten.
Sie haben nun den effektiven Bedarf gemessen, also wieviel Heizleistung nötig ist – während einer Heizperiode. Reichen drei Monate, um verlässliche Angaben zu erhalten?
Ja, in drei Monaten erhalten wir genügend Messpunkte, um die neue Heizleistung genau zu bestimmen.
Die Messungen, der Einbau dieser Regulierventile – das kostet auch. Sie kommen in ihrer Untersuchung zum Schluss, dass sich dieser Zusatzaufwand finanziell auszahlt. Erklären Sie.
Nehmen wir als Beispiel das Mehrfamilienhaus an der Zweierstrasse in Zürich. Das Gebäude wird derzeit mit Gas geheizt. Wenn der Energieverbrauch vor dem Ersatz genau gemessen wird, kann eine kleinere Wärmepumpe eingebaut werden, als wenn die Auslegung nur rein rechnerisch durch Vollaststunden bestimmt wird. Dadurch sinken die Investitionskosten um 250’000 Franken auf total 940’000 Franken . Wird zuvor der Verbrauch mit dem intelligenten Ventil optimiert, fallen die Kosten nochmals tiefer aus. Für dieses Objekt haben wir eine Investitionssumme von 800’000 Franken berechnet. Mit einer vorgängigen Optimierung können also nochmals 15% der Investitionen im Vergleich zur Variante mit einer Verbrauchsmessung gespart werden. Gegenüber den Einsparungen stehen Mehrkosten bei der Planung von 8’000.- Franken.
Unsere Messungen haben gezeigt: Eine vorgängige Optimierung lohnt sich bei jedem der vier untersuchten Objekte.
Bild: Ersatzinvestitionen durch Erdwärmesonden-Wärmepumpe, Zweierstrasse
Bei den vier Testobjekten in Zürich und Genf kann die neue Heizung also viel kleiner dimensioniert werden und damit auch Geld bei den Investitionen gespart werden. Sind diese Erkenntnisse allgemein gültig, können also auf andere Objekte übertragen werden?
Eine Stichprobe mit vier Objekten ist für eine Verallgemeinerung zu klein. Aber sie gibt immerhin Hinweise. Die Effizienz- und Kosteneinsparung muss weiterhin fallweise betrachtet werden. Für Mehrfamilienhäuser (acht oder mehr Wohnungen) mit fossiler Erzeugung ohne vorgängige Optimierungen kann aber festgestellt werden, dass mit unserem Vorgehen Effizienzpotenziale erschlossen werden können.
Die Bewährungsprobe steht noch an. Die neuen Heizungen werden in den vier Testobjekten erst noch eingebaut. Muss ich als Bewohnerin befürchten, dass ich meine Wohnung in einem eiskalten Winter nicht genügend heizen kann, wenn die Heizung weniger Leistung hat nach dem Ersatz?
Während der Optimierung in der Heizperiode sind bei allen vier Objekten keinerlei Reklamationen wegen zu kalter Wohnungen bei den Verantwortlichen eingegangen. Sprich die tiefere Heizleistung reicht für den Wohnungskomfort aus.
Wo sehen Sie in der Praxis Stolpersteine?
Für einen vorausschauenden Wärmeerzeugerersatz muss bereits ein bis zwei Jahre im Voraus mit der Planung des Umbaus der Heizverteilung begonnen werden, um den Vorteil der intelligenten Optimierung nutzen zu können. Dies wird die Herausforderung in der Umsetzung sein. Die Bauträgerschaften müssen realisieren, was sie rausholen können, wenn sie die bereits bestehende Heizung optimieren. Hier ist noch viel Sensibilisierungsarbeit nötig. Wir hoffen natürlich, dass unsere Projekteresultate dazu beitragen, dass das Optimierungspotenzial in der Praxis erkannt und auch umgesetzt wird.
Zum Schluss: Was gewinnt die Bauträgerschaft, was die Bewohnerinnen und Bewohner dank ihrer Erkenntnisse?
Bauträgerschaften können sich über tiefere Investitionen beim Ersatz von Heizungen freuen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner resultieren dank der Optimierung tiefere Nebenkosten, weil weniger Energie verbraucht wird fürs Heizen.
Text und Interview: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie
Bild: Zweierstrasse, Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Foto: Reto Schlatter
 Baugenossenschaft Zweierstrasse, Zürich
Baugenossenschaft Zweierstrasse, Zürich
 LuftwaffeInvestitionsbeiträge für Grosswasserkraftanlagen: Gesuche können weiterhin eingereicht werden.
LuftwaffeInvestitionsbeiträge für Grosswasserkraftanlagen: Gesuche können weiterhin eingereicht werden.  EnresaGeologische Tiefenlager: die wesentlichen Informationen auswählen
EnresaGeologische Tiefenlager: die wesentlichen Informationen auswählen  ShutterstockSind die Energieversorger fit für die Zukunft?
ShutterstockSind die Energieversorger fit für die Zukunft? 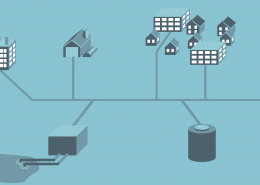 BFEEndlich Klarheit über thermische Netze
BFEEndlich Klarheit über thermische Netze 
 Sutterstock 2152231367
Sutterstock 2152231367 Shutterstock
Shutterstock
Trackbacks & Pingbacks
[…] Hier geht’s zum Beitrag von Brigitte Mader im Magazin des Bundesamts für Energie BFE […]
Kommentare sind deaktiviert.