Hochschule auf Netto-Null-Expedition
Die Ziele sind definiert, die Projekte gebündelt: Die ETH Zürich ist auf Expeditionskurs mit Ziel Netto-Null. Vieles ist noch ungewiss, doch eines ist klar: Es braucht Mut und Gestaltungswillen, um das Ziel zu erreichen. Gut, dass sich die ETH als Hochschule durch Innovation und Kooperation auszeichnet.
Im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und als Teil der Schweizer Bundesverwaltung ist die ETH Zürich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Das Programm «ETH Netto-Null» vereint alle Schulleitungsbereiche und Departemente für die Mitwirkung an der Reduktion der Treibhausgase. Die Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie die Flugreiseemissionen sollen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 2006 reduziert werden, die weiteren Scope-3-Emissionen um 20 Prozent. Erreicht werden soll dieses Ziel mithilfe von neun transformativen Projekten. Die beiden Team-Mitglieder von «ETH Sustainability», Dr. Sebastian Kahlert (Leiter ETH Netto-Null) und Julia Ramseier (Kommunikationsmanagerin), erklären im Interview, weshalb die ETH prädestiniert ist, um bei Netto-Null voranzugehen und wie der ETH-Campus und das Arbeits- und Studienleben dekarbonisiert werden können.
Im Frühjahr dieses Jahres wurde «ETH Netto-Null» gestartet. Wie reagierten die ETH-Angehörigen auf das Programm?
Sebastian Kahlert: Es gibt unter unseren Mitarbeitenden sowie Forschenden und Studierenden seit längerer Zeit eine klare Meinung zu einer Notwendigkeit des Handelns und einer damit verbundenen hohen Ambition der ETH. An einigen Stellen wurden bereits eigenständige Initiativen und Projekte lanciert. So wurden zum Beispiel in drei Departementen CO2-Steuern eingeführt, um Flugreisen einzudämmen und es finden verschiedene, von Mitarbeitenden angestossene, Pilotprojekte für einen ressourcenschonenden Laborbetrieb statt, wie zum Beispiel das Projekt GreenLabs. Die Resonanz zum Programmstart war daher überwiegend positiv. Dennoch gab es auch kritische Stimmen. Einige Angehörige der ETH äusserten Bedenken hinsichtlich der Umsetzbarkeit und Effektivität bestimmter Massnahmen. Die Kritikpunkte werden konstruktiv in den Diskussionsprozess integriert und führen zu weiteren Verbesserungen.
Weshalb ist die ETH Zürich prädestiniert, um als Vorreiterin und Vorbild der Dekarbonisierung voranzugehen?
Julia Ramseier: Als technisch-naturwissenschaftliche Hochschule kann die ETH Wissen und Technologien bereitstellen, um die Dekarbonisierung voranzutreiben. Wir gehören zu den führenden Hochschulen der Welt im Bereich der Klimaforschung. Zahlreiche unserer Professorinnen und Professoren befassen sich mit verschiedenen Aspekten des Klimawandels. Wir bieten unseren Studierenden eine grosse Auswahl an systemischen und interdisziplinär ausgestalteten Studiengängen sowie eine aktive Mitarbeit bei der Technologieentwicklung. Ausserdem eignet sich unser grosser und vielfältiger Campus ausgezeichnet als Reallabor zum Testen und zur Weiterentwicklung von neuen Technologien. Doch wir sind nicht nur prädestiniert, sondern sehen uns als Institution des Bundes seit jeher im Dienste der Gesellschaft. Das Klimaschutzgesetz gibt unserem Streben einen gesetzlichen Rahmen, den wir ambitioniert interpretieren und der uns motiviert, wirkungsvoll zu handeln. Die ETH geniesst in der Gesellschaft durch ihre Exzellenz im Wissenschaftsbereich viel Beachtung und hohes Vertrauen.
Eine wichtige Rolle auf dem Weg zu Netto-Null spielt die Dekarbonisierung des Campus. Wie soll diese gelingen?
Sebastian Kahlert: Unser Ziel ist es, den Einsatz der fossilen Energieträger auf dem Campusgelände bis 2030 zu minimieren und bis 2040 ganz zu eliminieren. Das bedeutet, dass wir alle Aktivitäten, die auf fossilen Brennstoffen basieren, reduzieren und/oder durch erneuerbare Energiequellen ersetzen werden. Bereits heute beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch rund 80 Prozent. Die Anfang der 2000er-Jahre getroffenen, weitsichtigen Investitionsentscheide zum Bau des Anergienetzes, ein dynamisches Erdspeichersystem für erneuerbare Wärme und Kälte, am Campus Hönggerberg zeigen Wirkung. In den nächsten Jahren ist ein weiterer Ausbau geplant. Fossil betriebene Blockheizkraftwerke konnten in der Zwischenzeit abgestellt werden. Weitere Massnahmen sind der Umstieg von Heizöl beziehungsweise Erdgas auf Biomasse, der Ausbau der Photovoltaik sowie die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. Genauso wichtig wie der Umstieg auf klimafreundliche Technologien ist jedoch auch die Steigerung der Energieeffizienz. Diese erreichen wir mit Gebäudesanierungen sowie der Eruierung und Nutzung von Einsparpotenzialen im Betrieb und in der Forschung.
Welches ist die neuste Massnahme zur Dekarbonisierung des Campus?
Sebastian Kahlert: Die neuste Massnahme ist die Integration einer Wärmepumpe/Kältemaschine mit einer Leistung von 3,2 Megwatt (Wärme) beziehungsweise 2,8 Megawatt (Kälte) ins Anergienetz am Hönggerberg. Die Anlage wählt je nach Kühl- oder Heizbedarf den Kalt- oder Warmleiter des Anergienetzes. Dank vier einzeln steuerbaren Verdichtern kann die Anlage flexibel an die jeweils aktuelle Nachfrage angepasst werden. Das Anergienetz mit Wärmepumpe/Kältemaschine ist ein hocheffizientes System zur umweltfreundlichen Wärme- und Kälteversorgung. Gleichzeitig ist es aber auch äusserst komplex, da es auf einer Vielzahl von Parametern basiert. Derzeit wird die Steuerungs-Software optimiert.
Gewisse Forschungsbereiche sind auf hohe Temperaturen angewiesen. Wie sollen diese künftig fossilfrei erzeugt werden?
Sebastian Kahlert: Die ETH experimentiert mit verschiedensten innovativen Technologien. So hat beispielsweise eine Forschungsgruppe aus den Bereichen Energie- und Prozesssystemtechnik sowie erneuerbare Energieträger eine thermische Falle entwickelt, die mit Sonnenlicht eine Temperatur von über tausend Grad Celsius erreicht. Der wesentliche Bestandteil der thermischen Falle ist ein Zylinder aus Quarz, der dank seinen optischen Eigenschaften Sonnenlicht effizient absorbieren und in Wärme umwandeln kann. Ein anderes Beispiel ist der in Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachhochschule entwickelte neuartige Ansatz für Wärmepumpen, mit welchem Prozesswärme bis zu 200 Grad Celsius erzeugt werden kann. Der innovative Ansatz basiert auf einem Kältemittel-Gemisch aus zwei Komponenten. 
Was sind die Herausforderungen auf dem Weg zu Netto-Null?
Julia Ramseier: Wir betrachten «ETH Netto-Null» als gemeinsame Expedition – als etwas, das als Ziel eines gemeinsamen Prozesses wahrgenommen wird. Es ist eine komplexe Aufgabe, die sowohl zentrale Weichenstellungen als auch individuelle Verhaltensänderungen innerhalb der ETH-Gemeinschaft benötigt. Dies wollen wir auch mit unserer diesjährigen Herbstkampagne zum Thema «Precious Resources – Kostbare Ressourcen» an der ETH zum Ausdruck bringen. Jede und jeder von uns kann ein Stück beitragen. Auch kleine Verhaltensänderungen, wie beispielsweise Bildschirme und andere Elektronik konsequent auszuschalten, wenn sie nicht gebraucht werden, oder Mehrweggeschirr zu benutzen, schützen Ressourcen und bringen uns näher zu Netto-Null. Daher gestalten wir bei «ETH Sustainability» als Koordinatorinnen und Koordinatoren diesen Prozess bewusst mit der ETH-Gemeinschaft zusammen, bieten den Angehörigen unserer Hochschule im Rahmen von Kampagnenwellen Anknüpfungspunkte, Anstösse für Verhaltensänderungen («Rethink your Routines») und Hintergrundinformationen. Eine weitere Herausforderung sind die Geschäftsreisen. Wir werden deshalb unsere Kampagne im nächsten Jahr dieser Thematik widmen. Zuletzt ist die grösste Herausforderung, die wir zugleich aber auch als Chance sehen, das Quantum Ungewissheit bei dieser Netto-Null-Expedition. Noch weiss niemand genau, wie es sich anfu?hlt, Teil einer Hochschule zu sein, die Netto-Null erreicht hat. Ganz sicher ist: Den Weg dahin gehen wir mit allen ETH-Angehörigen gemeinsam.
Julia Gremminger, Redaktorin für die Geschäftsstelle Vorbild Energie und Klima
Bilder: ETH Zürich
Vorbild Energie und Klima
In der Initiative Vorbild Energie und Klima (VEK) leisten Anbieter öffentlich relevanter Dienstleistungen und institutionelle Investoren ihren Beitrag zur Energiestrategie 2050 und zum Pariser Klimaübereinkommen von 2015. Der Fokus liegt auf Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und klimaverträglichen Finanzflüssen. Alle Akteure berichten transparent über ihre Zielerreichung und teilen ihre Erfahrungen, damit auch weitere Unternehmen und Organisationen sich daran orientieren können.
www.vorbild-energie-klima.admin.ch
 ETHZ
ETHZ
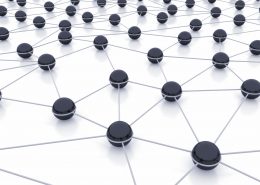 iStockphotoBlockchain – Ein Hype?
iStockphotoBlockchain – Ein Hype?  ZVG, Martin Omlin«Wärmepumpen werden oft zu gross dimensioniert.»
ZVG, Martin Omlin«Wärmepumpen werden oft zu gross dimensioniert.»  Billiger, sparsamer, moderner: 125 Jahre Werbung für das Heizen
Billiger, sparsamer, moderner: 125 Jahre Werbung für das Heizen  BFE - Brigitte MaderBFE-Wettbewerb an den Powertagen: Solarbag für den Netzelektriker
BFE - Brigitte MaderBFE-Wettbewerb an den Powertagen: Solarbag für den Netzelektriker 
 shutterstock
shutterstock Shutterstock
Shutterstock
Neuste Kommentare