Immaterielles Kulturerbe: Wie aus dem Baum Holzkohle entsteht
Gas oder Holzkohle: Mit welchem Energieträger das Steak, die Wurst oder der Maiskolben am besten gelingt auf dem Grill, darüber mögen die Meinungen auseinander gehen. Doch wer weiss, dass hinter der Herstellung von Holzkohle ein uraltes Handwerk steckt, das zu den lebendigen Traditionen der Schweiz gehört?
Sie werden als «die letzten Köhler» der Schweiz bezeichnet, die Köhler im Entlebuch. Sechs Plätze gibt es in den Wäldern von Romoos (LU) heute noch, wo die traditionellen Kohlemeiler zwischen Frühling und Herbst errichtet werden. Meiler nennt man die temporär gebauten Öfen, in denen aus Holz Kohle hergestellt wird. 50 bis 60 Tonnen Grillholzkohle produzieren die Romooser Köhler pro Jahr. Das ist ein Bruchteil dessen, was in Schweizer Grills verglüht.
Und so wird im Entlebuch aus Holz Holzkohle:
Meistens sind es Buchen, die für die Herstellung von Holzkohle gebraucht werden. Im Frühling werden sie gefällt, wenn sie noch keine Blätter haben. Der Stamm wird zu ein Meter langen Holzspälten zersägt, die dann gut belüftet und geschützt gelagert werden.
Die Konstruktion des Meilers ist eine aufwändige Arbeit. Die Holzspälten werden senkrecht nebeneinander aufgestellt, ganz nahe beieinander. Die Zwischenräume müssen möglichst klein sein. In der Mitte bleibt ein Schacht. Der Holzstoss wird dann mit Tannenästen belegt und mit Kohlestaub und Erde bedeckt. Dieser Mantel – im Fachjargon «Löschimantel» – muss absolut luftdicht sein.
Wegen dieser Decke kann das Holz nicht verbrennen, sondern es verkohlt nur. Mit Eisenstangen werden dann Löcher in den Meiler gemacht, aus denen nach dem Anzünden des Meilers der Rauch austreten kann. Die Aufgabe des Köhlers oder der Köhlerin ist es, den Brand zu regeln, indem er/sie diese Luftlöcher vergrössert oder verschliesst. Wichtig: Der Brand darf nicht erlöschen, es darf aber auch kein Vollbrand ausbrechen.
Wenn blauer Rauch aus den Löchern tritt, ist das Holz verkohlt. Am Ende des Verkohlungsprozesses, der rund zwei Wochen dauert, werden sämtliche Löcher verschlossen und der Meiler mit einer Plane luftdicht abgedeckt. So erstickt die Glut vollständig. Ist die Verkohlung so wie gewünscht abgelaufen, glänzt die Kohle, die unter der Löschidecke hervorkommt; und vor allem macht sie «Musik». In der Köhlersprache sagt man: Die Kohle klingelt. (Videos zum ganzen Köhler-Prozess finden Sie bei www.waldschweiz.ch und auf der Seite der Romooser Köhler)
Doris Wicki wuchs in einer Bergbauernfamilie in der Gegend von Bramboden im Entlebuch auf. Das Köhlern kennt sie von Kindsbeinen an. Heute zeigt sie Interessierten das Köhlerhandwerk. Sie ist ausserdem Europas einzige Köhlerin, die den Verkohlungsprozess alleine betreut.
Energeiaplus: Sie sind in einer «Köhler-Familie» aufgewachsen. War schon immer klar, dass Sie das Handwerk weiterführen werden?

Die Köhlerin Doris Wicki bei Drachslis, Bramboden, Gemeinde Romoos im Entlebuch. Sie ist die einzige Frau, die einen Kohlemeiler alleine betreut. Bild: Sarah Zumsteg.
Doris Wicki: Nein, das war es nicht. Ich habe Coiffeuse gelernt, bin auch heute noch teilweise in diesem Beruf tätig. Meine Brüder pflegten die Tradition. Sie wurden auch oft angefragt, vor allem von Gemeinden oder von Forstbetrieben, die das jahrtausendalte Handwerk vor Ort sehen wollten. Im Jahr 2004 war es für die Brüder wegen der Arbeit auf dem Bauernhof nicht mehr möglich, während drei bis vier Wochen auswärts zu sein. Da habe ich das Handwerk von meinem Vater und den Brüdern gelernt. Seit 20 Jahren bin ich nun von Frühling bis Herbst für verschiedene Köhlerprojekte engagiert.
Was ist für Sie der eindrücklichste Moment beim Köhlern? Gibt es Rituale oder spezielle Momente?
Für mich jedes Mal ein aussergewöhnlicher Moment: Wenn ich aus 80 Ster Kohle (entspricht einer rund 80 Meter langen und ein Meter hohen Holzbeige) die Kohle ernten kann.
Während der Verkohlung muss der Meiler permanent überwacht und betreut werden. Ein 24-Stunden-Einsatz. Wie organisieren Sie das?
Es ist eine Herausforderung. Den Verkohlungsprozess muss man steuern, damit das Holz verglüht und eben nicht verbrennt. Alle zwei Stunden muss man den Meiler bearbeiten, Löcher stopfen oder neue Löcher stechen, damit der Rauch austreten kann, den Löschimantel bewässern. Das ist ein 24-Stunden-Job. Ich bleibe dann auch über Nacht beim Meiler, lege mich zwischendurch kurz hin in der Hütte neben dem Meiler zum Schlafen.
Welche Fähigkeiten braucht ein Köhler, eine Köhlerin?
Es braucht das Wissen, welches wir von unseren Vorfahren erhalten haben. Zudem sind Ausdauer und ein gutes Gespür gefragt, wenn die Kohle am Schluss «klingeln» soll.
Sie sind Vizepräsidentin und Ehrenmitglied im Europäischen Köhlerverband e.V. Was sind ihre Hauptanliegen?
Die Hauptanliegen sind die Bewahrung und Pflege, die Präsentation und Weitergabe des traditionellen regionalbezogenen Köhler-Handwerks. Wir widmen uns der Förderung des Heimatgedankens und der Pflege von Brauchtum und Kultur in den Regionen Europas, wo noch heute das Köhlerhandwerk in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist.
Die Geschichte der Köhlerei ist eng mit der Abholzung von Wäldern verbunden. Wie gehen Sie mit diesem Erbe um?
Das Holz, das wir für die Köhlerei nutzen, kommt aus den eigenen Wäldern und wird vom Förster gezeichnet. Bei Bedarf werden Holzstämme auch zugekauft, aber nur aus der Region der Biosphäre Entlebuch.
Zum Schutz des Waldes wurde die Köhlerei mancherorts restriktiv geregelt. Wie war das in Ihrer Region?
Im Jahr 1941 wurde die Produktion von Holzkohle in unserer Region bewilligungspflichtig. Während 1939 bis 1945 produzierten die Köhler Holzkohle für industrielle und gewerbliche Zwecke. Sie leisteten einen nennenswerten Beitrag an die wirtschaftliche Landesverteidigung während des zweiten Weltkriegs.
Ein anderes Thema ist die ressourcenschonende Nutzung von Holz. Stichwort Kaskadennutzung. Das heisst, Holz erst ganz am Ende der Verwertungskette energetisch nutzen. Wie verträgt sich das Köhlern mit diesem Anspruch?
Fürs Köhlern wird nur Holz genutzt, das nicht als Bau- oder Möbelholz verwendet werden kann. Holzkohle kann man zudem nicht nur fürs Grillen nutzen. Der Energiegehalt ist hoch. Holzkohle kann auch als Bodenverbesserung, CO2- Senke, Wasser- und Nährstoffspeicher genutzt werden.
So kann Biokohle (Pflanzenkohle) ein Teil einer nachhaltigen Kaskadenutzung sein, wenn sie aus Reststoffen wie Altholz, Restbiomasse, Grünschnitt stammt und dauerhaft im Boden eingebracht wird.
Zum Schluss: Wie sieht es punkto Nachwuchs aus? Gibt es junge Leute, die in Ihre Fussstapfen treten?
Seit ich Präsidentin des Köhlerverbandes Romoos bin, durfte ich neun junge Mitglieder begrüssen. Dies sind wertvolle HelferInnen vor allem, wenn es um das Ausziehen und Abpacken der Kohle geht. Wir hoffen, dass die jungen Mitglieder das uralte Handwerk weiterführen.
Eine kurze Geschichte der Köhlerei im Napfgebiet
Die Köhlerei hat im Napfbergland eine Jahrhunderte alte Tradition. Weil die Wälder in der hügeligen Gegend lange unerschlossen blieben, war eine Stammholznutzung nicht möglich, und man verlegte sich auf die Produktion von Holzkohle. Allein in der Gegend Romoos (LU) lassen sich über 200 historische Kohlplätze nachweisen. Darauf weisen auch die zahlreichen aufs Handwerk bezogenen Flurnamen wie Chohlwald, Chohlgrabe oder Chohlbode hin. (Quelle: Köhlern im Entlebuch)
Der grösste Vorteil der Holzkohle: Sie wird heisser, wenn sie verglüht, als wenn man Holz verbrennt. Das hatten die Menschen schon früh erkannt und die Holzkohle zum Schmelzen von Metallen wie Bronze oder Eisen genutzt.
Die Geschichte der Köhlerei lässt sich rückblickend auch als eine Geschichte der Ausbeutung der Natur beschreiben. Wälder wurden weit über das natürliche Gleichgewicht hinaus abgeholzt. Laut wikipedia waren die Wälder anfang des 18. Jahrhunderts in Grossbritannien und später auch in Deutschland durch den zunehmenden Verbrauch von Holzkohle (und durch die anderen Verwendungen wie Schiffbau, Bauholz, Pfahlfundamente, Kanalbau etc.) so weit ausgebeutet worden, dass sich die Knappheit an Holzkohle in der Eisenproduktion zu einem ernsten nationalen Problem entwickelte. Als Alternative wurde dann Steinkohle fürs Heizen der Hochöfen in der Stahlindustrie verwendet. Die Köhlerei wurde zudem vielerorts reglementiert und eingeschränkt, um die Wälder zu schützen.
Text: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie
Bilder: Doris Wicki, wo nicht anders vermerkt
 Bild: Doris Wicki
Bild: Doris Wicki
 BFE - Brigitte MaderWie vegane Alternativen von Käse energie- und klimafreundlich produziert werden
BFE - Brigitte MaderWie vegane Alternativen von Käse energie- und klimafreundlich produziert werden 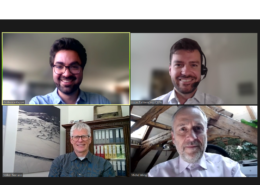 BFERed Lab und Climathons: Erfolgsmeldungen aus dem Open Innovation Programm
BFERed Lab und Climathons: Erfolgsmeldungen aus dem Open Innovation Programm  SuisseEnergieDes bâtiments historiques à la pointe de l’innovation
SuisseEnergieDes bâtiments historiques à la pointe de l’innovation 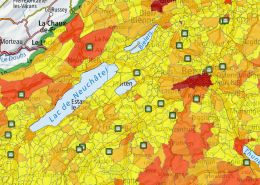 BFEOù sont les installations de biogaz ?
BFEOù sont les installations de biogaz ? 
 Shutterstock
Shutterstock SOLTOP Energie AG
SOLTOP Energie AG
Neuste Kommentare