Wieviel Strom wurde 2024 in der Schweiz produziert? Wer verbrauchte wieviel Strom? Wie sieht es punkto Import und Export von Strom aus? Alles Wissenswerte rund um die Stromversorgung findet man in der Schweizerischen Elektrizitätsstatistik, die das Bundesamt für Energie publiziert hat. Weiterlesen
Schlagwortarchiv für: Stromversorgung
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien 2024 erneut gestiegen
So viel Strom wie noch nie wurde in der Schweiz im letzten Jahr produziert. Massgeblich dazu beigetragen hat die Wasserkraft, aber auch die neuen erneuerbaren Energien werden immer bedeutender für die Schweizer Stromversorgung. Bereits über 13 Prozent des letztjährigen Landesverbrauchs von 62 TWh lieferten die neuen erneuerbaren Energien. Weiterlesen




 2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00
2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Unrentable Wasserkraft: Drei Gesuche für Marktprämie eingereicht
Wer im Jahr 2024 Strom aus einem unrentablem Grosskraftwasserwerk am Markt verkaufte, konnte beim Bundesamt für Energie (BFE) bis Ende Mai 2025 ein Gesuch für eine finanzielle Unterstützung (Marktprämie) einreichen. Drei Gesuchsteller haben für zwei solche Anlagen ein Gesuch eingereicht. Weiterlesen




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenNoch nie war die Schweizer Stromversorgung so transparent
Wie viel Strom wird in der Schweiz heute produziert und wie viel davon verbrauchen wir? Fragen wie diese lassen sich dank neuer Daten auf dem Energiedashboard des Bundesamts für Energie nun noch genauer beantworten. Weiterlesen




 3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00
3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Frühlingssession 2025: Ja zu Geld für Energieforschung und mehr Transparenz im Energiehandel
Ja zum Kredit für SWEETER, Ja zu strengeren Regeln für den Energiehandel und Ja zum Gasabkommen mit Deutschland und Italien. Das Parlament hat in der Frühlingssession wichtige Entscheide im Energiebereich getroffen. Nicht einig wurden sich die Räte beim Beschleunigungserlass und der Stromreserve. Eine Rückschau auf die Frühlingssession 2025. Weiterlesen




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenEin Vierteljahrhundert für die Windenergie
1986 wurde im Baselbiet die erste Windkraftanlage der Schweiz ans Netz angeschlossen. Heute produziert die Pionieranlage zwar keinen Strom mehr, dafür ihre Nachfolger. 47 Windkraftanlagen sind derzeit in der Schweiz in Betrieb. Weitere sind in Planung. Fast 25 Jahre war Markus Geissmann im Bundesamt für Energie (BFE) für das Thema Windkraft zuständig. Nun geht er in Pension. Was fasziniert ihn an der Windenergie? Wie blickt er auf seine Zeit als Leiter Windkraft im BFE zurück? Was hat ihn gefreut, wo sieht er die grössten Herausforderungen in Sachen Windkraft? Weiterlesen




 4 Vote(s), Durchschnitt: 4,25
4 Vote(s), Durchschnitt: 4,25Frühlingssession 2025: Parlament entscheidet über Energieforschung, Beschleunigungserlass und Energiehandel.
Sollen die Beschwerderechte gegen Energieprojekte eingeschränkt werden? Dies ist eine Frage, bei der sich National- und Ständerat beim sogenannten Beschleunigungserlass noch uneins sind. In der Frühlingssession 2025 des Bundesparlaments kommt das Geschäft darum nochmals auf die Traktandenliste. Die Session dauert vom 3. bis 21. März. Weiterlesen




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenAbnahmevergütung und Minimaltarife für Photovoltaik-Anlagen: Was hat der Bundesrat für 2026 beschlossen?
Wer Strom aus seiner Photovoltaik-Anlage ins Netz einspeist, verkauft diesen Solarstrom meistens an seinen Verteilnetzbetreiber. In der Schweiz gibt es rund 600 Verteilnetzbetreiber mit teils sehr unterschiedlichen Konditionen für die Einspeisung von Solarstrom. Ab dem 1. Januar 2026 wird sich dies ändern. Dann treten dafür neue gesetzliche Regelungen in Kraft, die der Bundesrat am 19.Februar 2025 im Detail beschlossen hat. Energeiaplus erklärt, worum es geht. Weiterlesen




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenNeu Januar 2025: Projektierungsbeiträge für Wasser- und Windkraftanlagen
Mit dem Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, dem die Schweizer Bevölkerung am 9. Juni 2024 zugestimmt hat, wurden neue Förderinstrumente eingeführt. Neu können Beiträge an die Projektierung von Wasser- und Windkraftanlagen beantragt werden. Weiterlesen




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenWintersession 2024: Parlament sagt ja zu BATE und Unterstützung für Stahl- und Aluminiumwerke
Unterstützung für die Stahl- und Aluminiumindustrie, mehr Transparenz für den Stromhandel und schnellere Verfahren für den Bau grosser Energieproduktionsanlagen. Das eidgenössische Parlament hat wichtige energiepolitische Entscheide gefällt in der Wintersession 2024, die am 20. Dezember zu Ende ging. Ein Überblick. Weiterlesen




 Noch keine Bewertungen
Noch keine BewertungenKontakt
Bundesamt für Energie
Pulverstrasse 13
3063 Ittigen
Postadresse:
Bundesamt für Energie
3003 Bern
Telefonnummern:
Hauszentrale +41 58 462 56 11
Pressestelle +41 58 460 81 52
Newsletter
Sitemap
 Medienmitteilungen des BFE
Medienmitteilungen des BFE
- Ein Fehler ist aufgetreten – der Feed funktioniert zurzeit nicht. Versuchen Sie es später noch einmal.
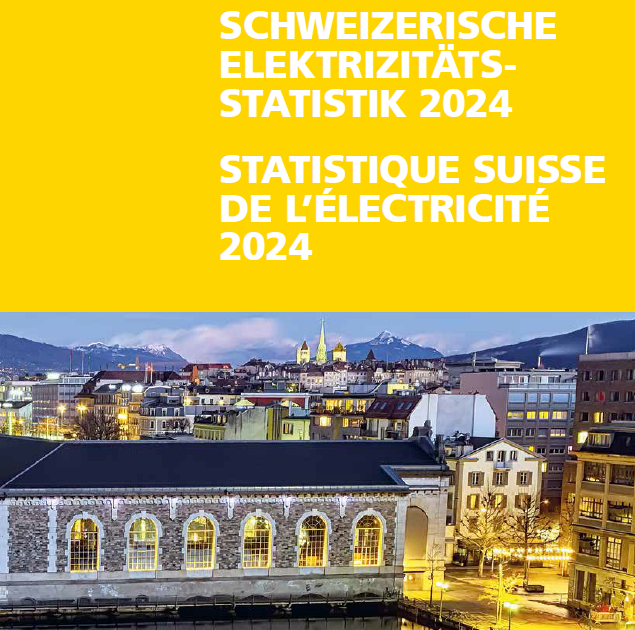
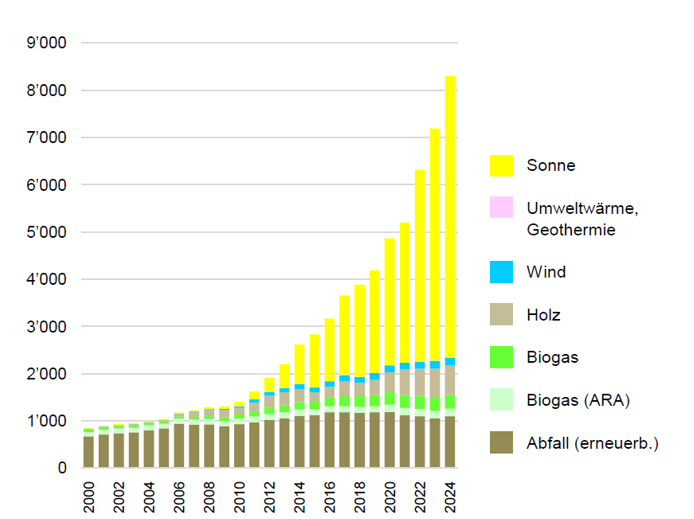 BFE
BFE Luftwaffe
Luftwaffe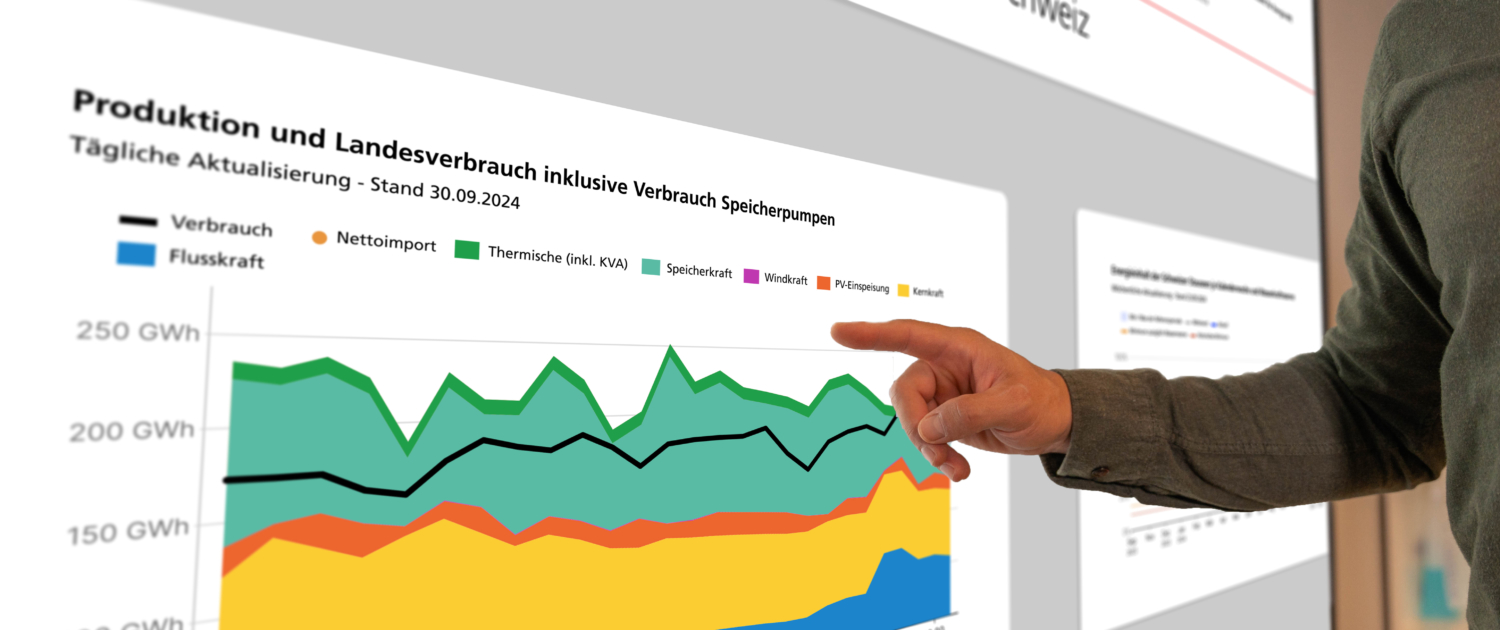 BFE
BFE Parlamentsdienste
Parlamentsdienste BFE
BFE Parlamentsdienste
Parlamentsdienste shutterstock
shutterstock keystone-sda (bearbeitet BFE)
keystone-sda (bearbeitet BFE) Parlamentsdienste
Parlamentsdienste